Das Akronym AfD habe ich vor etwa zweieinhalb Jahren, als ich meinen Roman „Alle ungezählten Sterne“ schrieb, mit „Angst für Dumme“ übersetzt, ein Euphemismus, den ich heute, in diesem bitterkalten Januar 2024, vermiede und für den ich mich schäme. Mein Romantitel stellt seinerseits, neben seiner in der Handlung und im Denken und Fühlen meiner Figuren verankerten Metaphorik, ein Akronym dar: „Alle ungezählten Sterne“ steht, da es um die Lebensbilanz meines Erzählers geht, auch für dessen Aus.
Die Hetze der selbsternannten „Alternative für Deutschland“ hat in der aufgedeckten Potsdamer Geheimkonferenz die Hässlichkeit ihrer Fratze in aller Deutlichkeit gezeigt. Diese Alternative, das sollte nun jedem Menschen klar sein, der sehen kann, ist keine verkappt, sondern eine offen neofaschistische. Das Ansinnen dieser Leute, die keine Menschen sind, da sie nichts Menschliches an sich haben, gründet auf Herabwürdigung und Verächtlichkeit. Erbarmungslos hat sie Ausgrenzung und Abschiebung, Spaltung und Säuberung zum Ziel.
Niemand, der morgen nicht in einer Diktatur aufwachen will, sollte sich mit Beginn dieses bitterkalten Jahres schlafen legen, um schweigen zu können. Zum ersten Mal, seit ich denken kann, hat der nie vergangene, der stets latente deutsche Fremdenhass Einzug gehalten in bis heute für integer gehaltene Kreise von Kultur, Kunst, Literatur, Musik und deren Betriebe und Verwaltungen. Das braune Netzwerk breitet sich darin mühelos aus, da es überall Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen findet. Der endlich erwachte Widerstand durch große, wenngleich noch viel zu geringe Teile der Bevölkerung macht mir Mut und gibt mir Zuversicht. Ich hoffe, auch die Künste wachen jetzt auf aus ihrem Corona-Dämmer und Profitschlummer und stellen, ohne sich zu verleugnen und ohne sich zu instrumentalisieren, eine unmissverständlich menschliche Barrikade auf.
Erinnert sei an Klaus Mann, der vor genau 90 Jahren seinen ersten Exilroman veröffentlichte, „Flucht in den Norden“, in dem es gegen Ende hin über unser Land heißt: „Es ist so lächerlich unbegabt für das Leben, dieses Volk mit seiner dünkelhaften Extraproblematik, daß es niemals, niemals eingetreten ist in den Kreis der Zivilisation. Das ist der Grund, das ist der einzige Grund, warum es unsere Zivilisation bedroht, zu der es den Zutritt nicht hat. Und nun ist es wieder einmal aufgestanden und will alles kaputtschlagen, und alle Welt muß zittern und sich Sorgen machen und höflich sein mit diesen bösen Narren. Was für ein Volk! Pfui, es macht ja eine große Übelkeit, sich’s vorzustellen – ekelhafd ist es, an ihre Tüchtigkeit zu denken, die sich immer in den Dienst der Gemeinheit begeben hat, an all ihr Talent, das kein moralisches Rückgrat besitzt. Wenn mir ihre Professoren und Zeitungsleute einfallen, wird mir womöglich noch übler, als wenn ich mir ihre Generale und Henker ausmale, denen die Professoren eine ,Weltanschauung‘ liefern, gebrauchsfertig, in tadelloser Verpackung. Und nun, da dieses Volk endlich das dünne Mäntelchen abwirft, das es bis jetzt noch pro forma vor seine kolossalische Mißratenheit halten mochte, und da es nun hervorspringt in seiner ganzen unseligen Frechheit – warum sollte man denn da so sehr den Überraschten spielen?! Das ist keine Überraschung für einen, der zu sehen verstand.“
An die Sternen
IHr lichter die ich nicht auff erden satt kan schawen /
Ihr fackeln die ihr stets das weite firmament
Mitt ewren flammen ziert / vndt ohn auffhören brent;
Ihr blumen die ihr schmückt des grossen himmels awen
Ihr wächter / die als Gott die welt auff wolte bawen;
Sein wortt die weisheit selbst mitt rechten nahmen nennt
Die Gott allein recht misst / die Gott allein recht kent
(Wir blinden sterblichen! was wollen wir vns trawen!)
Ihr bürgen meiner lust / wie manche schöne nacht
Hab ich / in dem ich euch betrachtete gewacht?
Regirer vnser zeitt / wen wird es doch geschehen?
Das ich / der ewer nicht alhier vergessen kan /
Euch / derer libe mir steckt hertz vndt Geister an
Von andern Sorgen frey was näher werde sehen.
„An die Sternen“, ein Sonett von Andreas Gryphius (1616 – 1664), ist Teil der dritten Sammlung des Dichters und erschien gegen Ende seiner niederländischen Studienjahre 1643 in Leiden. Ein Jahrzehnt jünger als Rembrandt, der die Universitätsstadt 12 Jahre zuvor verlassen hatte, war Andreas Greif aus Glogau in Schlesien, der sich Gryphius nannte, da 27 und seit sechs Jahren poeta laureatus. Anders als von „Es ist alles eitell“ und „Menschliches Elende“ gibt es von „An die Sternen“ keine Erstfassung in den „Lissaer Sonetten“. Auch deshalb erscheint mir „An die Sternen“ einzigartig und wundervoll. In meinen Augen ist das fast 380 Jahre alte Gedicht eines der schönsten in meiner Sprache. Lesen lässt es sich als Anrufung, Huldigung oder Preisung der Himmelsgestirne und somit, wenn man will, Gottes, von dessen Welterschaffung sie Zeugnis ablegen. Davon sprechen jedoch allein die ihre Alexandriner wie auf stellaren Bahnen über die Zeilen führenden Verse der beiden Quartette. Die in den Anfang zurückmündenden sechs Zeilen der mit schweifenden Reimen versehenen Terzette erzählen dagegen von der Lust des dichterischen Gemüts am Staunen über die Welt und ihre Darstellbarkeit durch das so hell wie ein Stern leuchtende Wort. Es geht Gryphius um das gar nicht göttliche, vielmehr immer aufs Neue aus dem eigenen Ich schöpfende Wunder der Benennung: eine Lebendigkeit stiftende Kraft, die der Dichter stellvertretend für jeden festzuhalten versucht, der wie er nach Spuren und Zeichen der „Herz und Geister ansteckenden Liebe“ sucht. Ich stelle mir, wenn ich „An die Sternen“ lese, auch Andreas Greif vor, in einer Nacht unter freiem Himmel, den Blick erhoben, staunend, rätselnd und sicher nur seiner selbst.
Bresche
Kunst tauge nicht zu Propagandazwecken, sondern gehöre zur „Gegenwehr der Menschen gegen den Krieg. Deshalb kann auch die Behinderung von Kunst oder Künstlern kein Akt gegen den Krieg sein“, schrieb Alexander Kluge am 13. April in der Süddeutschen. „Kunst ist kein Richter. Kunst trainiert Wahrnehmung. Die Kriegssituation ist eine Welt der Algorithmen. Die Kunst ist der Anwalt der Gegenalgorithmen.“ Es sind dies die vielleicht einzigen Sätze, die ich während der völkerrechtswidrigen und durch nichts zu rechtfertigenden russischen Invasion in der Ukraine gelesen habe, die mich trösten können. Sie könnten, würden wir ihn hören können – denn er ist nicht gestorben –, ebenso von Oscar Wilde stammen – der den Krieg einer ganzen von Dünkel und Vorurteilen gelenkten Gesellschaft gegen einen Einzelnen am eigenen Leib erfahren musste. Wladimir Putins Europa aufoktroyierter Krieg ist ein Angriff auch auf die Werte, für deren Einsetzung und Erhaltung unzählige Künstlerinnen und Künstler seit Jahrhunderten gestritten haben. Man lese nur George Orwells Visionen „1984“ und „Animal Farm“, lese sie, anstatt sie abzutun als allzu bekannt und Schullektüre. Theater, Dichtung, Tanz, Fotografie, Ballett, Video und Malerei und Zeichnung und Plastik – und Musik! – und Übersetzung – reichen tiefer und drücken tastend oder schreiend, laut oder leise, mehr aus, als dass sie instrumentalisiert oder funktionalisiert werden könnten selbst in Zeiten extremster menschlicher Auseinandersetzungen. Was uns dazu führt, andere zu überfallen, abzuschlachten, zu vergewaltigen und auf offener Straße hinzurichten, den Zusammenbruch des Minimums an menschlichem Miteinander, alles, jede Freude und jedes Gräuel, jeder echte Austausch und jede Untat, wird stets – seit Jahrhunderten und -tausenden – thematisiert in den Künsten, die frei sind, sich freigerungen haben von Staat und Kirche, jedweder Inquisition, gerade deshalb. Kunst hat keine Funktion, nicht mal eine Aufgabe, so wenig, wie ein Kind sie hat. Sie ist Ausdruck von Lebendigkeit und damit Unterschiedlichkeit, wie jedes Kind. Nein, ich bin kein politischer Mensch. Ich misstraue jedem, jedem Axiom, das nicht, wie Keats sagt, am Puls überprüft wurde. Der Zweifel an aller politischen Äußerung ist mein Terrain. Und so wäre es auch unter einer Tyrannei wie jener Putins. Doch ich glaube fest, ja unverbrüchlich an einige wenige menschliche Werte, und es ist kein Zufall, dass ich sie in nur zwei dichterischen Texten der letzten achtzig Jahre ausgedrückt finde, Gedichte, die sich jeder Vereinnahmung zu entziehen vermochten: Ezra Pound wurde in einem Käfig gefangengehalten, weil er sich für Mussolini einsetzte, und schrieb dennoch den Abschluss des Canto LXXXI: „What thou lovest well remains, / the rest is dross.“ W. H. Auden drückte seine Bestürzung über den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in seinem Gedicht „September 1, 1939“ aus und fand darin zu einem Vers von nahezu galaktischer Bedeutsamkeit: „We must love one another or die.“ Man lese es nach, es steht ja alles im Netz.
Fragment eines Kriegstagebuchs
Dieselben Sternbilder am Nachthimmel
wie letzten Winter. Ich bin entsetzt
beim Anblick des Bahnsteigs
voll Tausender, die auf die Gleise,
dann auf der anderen Seite herumströmen
um den viel zu kurzen Zug. Das Foto lässt sich
großzoomen, und da erscheinen vor allem Frauen,
Kinder, Alte, wie auf allen Kriegsdarstellungen,
die ich kenne. Frau mit roter Kapuze,
Kind auf dem Arm. Was hast du,
frage ich mich, von Kriegen
wirklich miterlebt. Jedenfalls Angst.
Drohungen. Bedrohungen. Die Zeit wie
angehalten in diesen Tagen. Was soll da erst
die Frau mit roter Mütze sagen. Freiheit wird siegen.
Du musst dich begnügen. Auf der A5 öfter schweres Militär,
Armeetransporter, und einmal die blaugelbe Fahne
im Seitenfenster eines vorbeiziehenden Horch.
Und die Gespräche Schein. Und die Attacken
unsichtbar. Einen Nachmittag lang hinaufgewandert in
das felsige Bergland, auf dem Schotterpfad weiße Splitter,
vorbei an den Grotten, an Olivengärten, schon gehen
die Augen wieder auf, schon möchte ich überall
am Körper Augen haben. In der Luft zu hören
die Dohlen, seltsam aufgeweckte Raben,
auf dem Smartphone der Einschlag
einer Rakete in Cherson und der Staub
im rasselnden Laub. Ich bin aufgewacht
nach wochenlangem Albtraum im eigenen
Leben, andere schwer vorstellbar, zu schwach
für großstädtische Barmherzigkeit, es tut mir leid.
Wir fahren durch die Nacht. Heim von der Crêperie
in Forcalquier. Die Kids auf den Rücksitzen zählen sie:
die Toten durch die Pest, die Toten durch Corona, die Toten
im Krieg in der Ukraine. Welche Sprache spricht man da?
Die Sternbilder wie immer. Das große W – Kassiopeia.
Orion. Der kleine Bär. Vorm Nachthimmel steht
die Roche amère. Polen bittet die USA,
eigene MIG-21-Düsenjägerbestände
an die Ukraine zu überstellen. Und du
fühlst dich wie? Am vierzehnten Tag nach
dem russischen Angriff auf die Ukraine erklärt
der russische Außenminister Lawrow, Russland
habe die Ukraine gar nicht angegriffen. Was
kann wirklich sein in einer Wirklichkeit,
wo die Lüge sich ins Recht setzt.
Ein Kinderkrankenhaus beschossen.
Mariupol. Wöchnerinnen im Raketenfeuer.
Fünftausend russische Soldaten gefallen, gefallen,
gefallen, gefallen, gefallen, gefallen in nur zwei
Wochen. Ihre schneebedeckten Panzer mit
grillofenähnlichen Gerüsten auf dem Turm,
langsam dahinschepperndes Gerät, abgeladen
irgendwo in Belarus und über die Grenze gerollt, um
die erste nächtliche Kanonade abzufeuern, hinein
ins Vorland von Lwiw. Ich denke an Claude
Simons Schilderungen des Krieges als
das menschliche Nichts, Schlamm,
Matsch, Unrat, Plunder, Müll,
in Fetzen geschossen, das Vieh
halb eingesunken in den Sumpf aus
Stumpfsinn, Angst, Abfall. Simon beschreibt
in „Die Schlacht bei Pharsalos“ die Fassungslosigkeit
der Söldner, erfahren im Kampf Mann gegen Mann,
angesichts der Enge, kaum Raum und kaum Zeit,
auf dem durchstrukturierten Schlachtfeld. Ich
suche auf Google Maps Grodek, scrolle
durch Fotos meines Freundes Farhad
aus Czernowitz vom letzten Sommer, ich
lese, wo Berdytschiw liegt, der Geburtsort
Józef Konrad Korzeniowskis, womit ich Joseph
Conrad meine. Ich war noch nicht in der Ukraine.
Es ist der 11. März. Nächste Nacht erwartet
Odessa die Einkesselung, und ich denke
an meinen Freund Jürgen, der im Mai
mit dem Rad an Kiew vorbei bis
ans Schwarze Meer wollte,
einen Blick werfen auf die Krim,
und denke an meinen Freund Steffen,
den Kosmonauten aus Leipzig, Gagarin2.
Woran erinnere ich mich von seinen Bildern
aus dem Niemandsland um Tschernobyl:
das Grün. Auf der anderen Seite ist
das Gras immer grüner. Tam
choroscho, gde nas njet. „Keiner
hört mich. Ich lalle und meine Hände
sind immerfort in Bewegung, denn
die Liebe ist unsterblich und lebt
weiter in Träumen und Gesichten“,
schreibt Emma Lew in dem Gedicht
„Tschernobyl: Smalltalk“. Krieg heißt
für die, die ihn erleben müssen, die
Unwirklichkeit zeigt ihr zerrissenes
Gesicht. Sie will das Wirkliche sein
und frisst es doch auf. Der Erzähler
Sergei Gerasimow schildert den Luft-
angriff auf Charkiw und beschreibt die
Geräusche erster Raketen und erster
Einschläge, ein nie zuvor gehörtes
Sirren und Gejaul, vermengt mit
ungeheuerlicher Stille, mit der
der Erwartung, mit dem Schweigen
zwischen Einsetzen der Furcht und
Eintreten des Befürchteten. Der Krieg
ist der Riss im Blick, in sieben Sinnen
quer durch dich, aber was weiß davon
ich. „es gibt viele häuser die stehen aber
es gibt keine mitte es gibt viele wege die
führen doch sie führen zu keiner mitte“,
dichtet Tadeusz Różewicz in derselben
Welt. CNN Grodek. Gekappt. Ende
vom Glauben ans Glück, alle elende
Utopie. Heute stand ich auf einer 2025
Jahre alten Brücke und fühlte mich wie?
Ihr letzter Tag, Herr Präsident
Ihr letzter Tag, Herr Präsident, bricht an.
Bitte verlassen Sie das Weiße Haus,
Sie blinder, irrer, mieser alter Mann,
Und schaffen Sie ihr dummes Zeug hinaus
Und weg in Ihre Sonne. Nehmen Sie
Die Paladine mit, mit die Claqueure,
Die scheinbar wahre Scheindemokratie.
Ich höre Stimmen und die Tiere, höre
Die Sie so lange stützten, so elendig
Gekaufte Meute. Bäume twittern Tweets:
Schluss! Ende der Verelendung! Lebendig
Entgehen wir seiner Verbalmiliz.
Von Ihnen, fetter Clown des Fakes,
Lernt die kaputte Welt: Bleib unterwegs.
New Year’s Day
England in 1819
An old, mad, blind, despised, and dying king, –
Princes, the dregs of their dull race, who flow
Through public scorn, — mud from a muddy spring, —
Rulers who neither see, nor feel, nor know,
But leech-like to their fainting country cling,
Till they drop, blind in blood, without a blow, —
A people starved and stabbed in the untilled field, —
An army, which liberticide and prey
Makes as a two-edged sword to all who wield
Golden and sanguine laws which tempt and slay;
Religion Christless, Godless — a book sealed;
A Senate, — Time’s worst statute unrepealed, —
Are graves, from which a glorious Phantom may
Burst, to illumine our tempestous day.
Percy Bysshe Shelley
Zum Tag des inhaftierten Schriftstellers 2018
Der ukrainische Schriftsteller und Filmemacher Oleg Sentsov wurde wegen angeblichem Terrorismus in einem unfairen Prozess von einem russischen Militärgericht zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Sentsov sagte dabei aus, dass ihm Folter angedroht worden sei. Derzeit befindet er sich in einer sibirischen Strafkolonie für Schwerkriminelle in Labytnangi, tausende Kilometer entfernt von seiner Heimat auf der Krim. Zuletzt verbrachte er 145 Tage im Hungerstreik und forderte die Freilassung aller in Russland inhaftierten ukrainischen Häftlinge aus politisch motivierten Gründen. Er beendete seinen Streik am 6. Oktober 2018, da er befürchtete, zwangsernährt zu werden. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sentsov den mit 50.000 Euro dotierten Sacharow-Menschenrechtspreis erhält. Die Preisverleihung ist am 12. Dezember in Straßburg geplant, doch dass Russland den Autor dazu ausreisen lässt, ist unwahrscheinlich.
Sentsov wurde im Mai 2014 von den russischen Sicherheitsdiensten auf der Krim festgenommen. Seinen Aussagen zufolge wurde er drei Stunden lang körperlich misshandelt, geschlagen und sexuell missbraucht. Er wurde nach Russland gebracht, wo er über ein Jahr in Untersuchungshaft verbringen musste. Im August 2015 wurde er nach einem äußerst unfairen Verfahren vor einem russischen Militärgericht zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wurde ein Antrag auf Auslieferung in die Ukraine mit der Begründung verweigert, dass er nach der Besetzung und Annexion der Krim durch Russland zu einem russischen Staatsbürger geworden sei.
Der internationale PEN geht davon aus, dass Oleg Sentsov für seinen Widerstand gegen die russische Annexion der Krim inhaftiert wurde, und fordert die russischen Behörden auf, den Autor und Filmemacher unverzüglich freizulassen, seine Menschenrechte, einschließlich des Verbots von Folter und anderen Misshandlungen, und sein Recht auf ärztliche Behandlung zu respektieren.
Raute
Zum Tod von Günter Herburger
Saurüssele
Das Wichtigste,
was man von Schweinen
lernen kann: kein Mensch zu sein.
Sie sind sehr sauber,
sehr gefühlvoll, ein wenig zänkisch,
kämpferisch, aber dann lieben
sie einander wieder,
und wenn sie weinen,
was sie gerne tun, schreien
sie kaum und lächeln dabei.
Einen Tag, bevor sie
geschlachtet werden sollen,
sind sie nervös und konfus,
rennen umher und beschmutzen sich.
Dann beginnen sie zu singen,
sehr tief und sehr hoch,
wir vermögen es nicht zu hören.
Kein einziges Schwein ist bekannt,
das alt, krank und mager
noch auf der Weide lebte,
ganz und gar nicht allein,
weil umgeben von Igeln,
sodass, wenn es stirbt,
es auch ein Häufchen wäre,
bedeckt von Blättern und Geschmeiß,
deren Konzerte
wir niemals vernehmen.
Günter Herburger
6. April 1932 – 3. Mai 2018
Der tyrannische Autor
Vor rund vier Wochen wurde ich von der Frankfurter Allgemeinen gebeten, Botho Strauß’ neues Buch „Der Fortführer“ zu besprechen. Heute erschien meine Rezension in der FAZ, allerdings in einer an empfindlichen Punkten des Textes eingekürzten Version. Meine Kritik an Strauß’ Verächtlichkeit gegenüber Leserinnen und Lesern, die er für minderbemittelt zu halten scheint, oder an seiner Pauschalherabwürdigung der Frau („ältestes Lasttier des Menschen“) wurde aus der Besprechung getilgt, aus Platzgründen, wie es heißt. Das Ende fehlt ganz. Deshalb hier meine ursprüngliche Rezension des Buches, wie ich sie von Mitte bis Ende März in Lenzburg im Aargau geschrieben habe:
Botho Strauß
Der Fortführer
Rowohlt Verlag
Reinbek bei Hamburg 2018
208 Seiten, 20 Euro
Von Mirko Bonné
Fortführen kann ich die Zoohandlung meiner Tante. Oder meine Tante selbst, so sie denn fortgeführt werden möchte oder muss. Bin ich dann Fortführer? Eher Fortführender. Der Fortführer bin ich erst im Wortspiel mit dem Wortführer.
Der Rahmen, in den Botho Strauß seine neuen Aufzeichnungen stellt, ist durchaus ansprechend. Zwei Teile hat „Der Fortführer“, Abfolge und Gewichtung sind überlegt und aufeinander abgestimmt. Der erste macht zwei Drittel des in gedeckten Farben gehaltenen, klassisch, ja bedeutend anmutenden Buches aus: „Zwischen Jetzt und Nu“ umfasst vierzehn unbetitelte, ihrer Kürze und motivischen Verknüpfungen wegen mühelos lesbare Kapitel – nur ein einziges Notat ist länger als eine Seite. Versehen mit unterschiedlichen Einzügen, sind alle kleinen und größeren Absätze übersichtlich, wenn nicht einladend über die Seiten verteilt, wo sie wie Strophen wirken, denn es fällt auf, dass dieser erste Buchteil im Flattersatz gehalten ist.
Nicht so der zweite, das abschließende Drittel, das dem Buch den Titel gibt. Auch hier Aufzeichnungen, nur fehlen Kapiteleinteilung und graphisches Spiel. Notate, in herkömmlicher Weise gestaffelt: bündig, ohne Einzüge. Wenn man bereit ist, gestalterische Elemente als aufgeladene Zeichen zu deuten, liegt in der formalen Raffinesse des Buches ein gewisser poetischer Reiz. Ansonsten aber ist „Der Fortführer“ ein haarsträubendes Elaborat aus verächtlichem Raunen und unfreiwilliger Komik.
Zentrales Thema scheint das Zeitliche zu sein: Vergangenheit, Vergänglichkeit. Augenblick, Dauer. Tradition, Überlieferung. Strauß geht es jedoch nicht um Alter, Muße, versöhntes, erfülltes Leben und Miteinander heute. Sein Anliegen ist nicht Verständnis. Es zählt nur Wille zur Erkenntnis. Sein Projekt ist eine restaurative Schubumkehr, zu deren Zweck er sich zum so unverstandenen wie wissenden Künder eines nahenden Heroenzeitalters stilisiert, dem Fortführer.
Sosehr hier einer erläutern zu müssen meint, was das Poetische sei, was Poesie und was Dichtung – für Strauß offenbar Synonyme, differenziert wird nicht –, so wenig poetisch sind seine Sätze. Die Bilder sind unausgewogen und schief („Grille und Geist – beide reglos vor dem jähen Sprung“), was verschwurbelte Wortwahl und gedrechselter Satzbau immer wieder kaschieren müssen. Metaphern wirken abgegriffen und instrumentiert, rhetorische Figuren zweckgebunden, durchsichtig, bemüht: „War nicht am Ende alles Richten und Zerstören bloß der Tanz zu einflußreicher Musik, die von unsichtbaren Terrassen herüberklang und zu den kühnsten Handlungen aufspielte?“ Geht es noch?
Wortspiele („Narretei des Narrativs“), Stabreime („Da! Damals“), metrische Raffungen („Und so, wie’s war, kann’s keiner fassen“), Wie-Vergleiche (der Kummer „beinahe wie ein Pferd“, der Kummer „wie eine feuerfeste Kastanie“) und Zitate über Zitate, griechische, lateinische, englische und französische, deren Übersetzungen genussvoll-schulmeisterlich gleich mitgeliefert werden – alles um klarzustellen, wo der Fachmann hier den Hammer hängen hat.
Des Fortführers Werkstatt ist seine „Bibliodizee“. Fledermausartig fliegen dort Fremdwörter umher. Zum Lachen geht man in den Keller. Nur selten leuchtet zwischen den Zeilen etwas, das an Lebenswärme, an weitererzählte Erfahrung erinnert. Ein alter Mann fällt an derselben Stelle in den Matsch wie viele Jahre zuvor sein kleiner Sohn: „Man gräbt sich in den Weg, von dem man einst sein Mannesalter von einem Kind empfing.“ Das Bild mag überfrachtet sein, gibt aber zu denken und bleibt trotz des steifen Tons im Sinn, weil es sich einfühlt und anrührt. So plump hier mit pseudo-poetischen Mitteln manipuliert wird, ist Botho Strauß’ neues Buch stilistisch gesehen jedoch fast durchweg bestenfalls enttäuschend.
Der Flattersatz des ersten Teils erinnert nicht zufällig an die bei Online-Texten übliche Form: Netz, Smartphone, digitale Kommunikation und die oft vorgegaukelt freie Verfügbarkeit von so vielem, darunter Partnerschaft und Sex – ein Themenbereich, dem Strauß sich in „Zwischen Jetzt und Nu“ widmet, indem er als bewusst Außenstehender kritisch und um einen eigenen Blick bemüht betrachtet, was für die meisten Leute einfach bloß Alltag ist oder zu sein scheint. Wer will die Wünsche anderer verdammen?
Es ist der eigene Blick dessen, der sich als „Phantast, Archaiker und Träumer“ versteht und in Abwandlung des Ausklangs von Hölderlins Hymne „Andenken“ fordert: „Wir müssen Verwirrung stiften wie einst die Dichter das Bleibende“ – ein Beispiel für Strauß’ ungenaues Lesen: Bei Hölderlin stiften die Dichter nicht das Bleibende, sondern das, „was bleibet“: Worte, Verse, Sprachmusik, Musik der Wörter und der Bedeutungen. Das Bleibende ist viel zu groß.
Verwirrung stiftet „Der Fortführer“ allerdings. Vor allem im zweiten Buchteil wird zu einem Rundumschlag ausgeholt gegen jede Form heutiger Technologie und im Hauruckverfahren damit gleichgesetzter Lebensgestaltung: „Mit den Händen eine Kelle formen, unseren Hirnglibber ausheben und in die digitale Schale betten. Wir sollen nur umgefüllt werden.“ Dieses Wir, wer ist das? Es ist rhetorische Pose. „Kommunikation und Verwesung“, nach Strauß „ein und dieselbe leibliche Wucherung, dieselben Gänge benutzen Nachrichten und Würmer.“ No comment. Dagegen kann es lediglich „der drangvollsten Botschaft“ gelingen, „auf der Liebe und des Äthers Wellen“ größere Entfernungen zu überwinden. Telefon? Skype? Nicht in der angeblich höheren Welt, die Strauß entwirft, wenn auch für nur einen Bewohner. Der sagt von sich: „Mitten im Gewühl den Kopf überm Gewühl.“ Er scheut davor zurück, zu nah an jemanden heranzutreten: „Ein Eishauch könnte seiner Brust entweichen und den anderen erstarren lassen.“ Auch das ist Pose, und wenn Poesie, dann die eines Superhelden, einer Mischung aus Iceman und Deadpool.
Erstarren lässt bei der fortgeführten Lektüre tatsächlich manches: „Die Seele (…) wird die Form eines Rachevogels annehmen und die Gespenster der Freiheit verscheuchen.“ – „Dieselbe Technik, die die optische Verschmutzung unter die Menschen brachte, ermöglicht auch, den Erdball einer photo-klastischen Reinigung, bildlichen Auslöschung, zu unterziehen.“ – „Auch sind es nicht allein die paar Dutzend heroischen Kunstwerke der Menschheit, sondern es ist das unüberblickbare Heer der von ihnen inspirierten, angetriebenen Nachfolger und Kombattanten, die alle gemeinsam sich zum Feldzug sammeln gegen den Ansturm der jungen Tage. Auf keinen Krieger kann man verzichten.“ – „Erst im Zeitalter der sozialen Netzwerke gewinnt asozial neue Konturen.“ – „Das Leicht-Deutsch aus Erkennungszeichen für die Masse der kommunikativ Sprechenden und das entfaltete für die, die ihr Hirn für anspruchsvollere Zusammenhänge fit halten müssen.“ – „Wider den Mißbrauch der Schrift beim Chatten! Beim Quatschen läßt man ja auch von der Schrift!“ – „Debilwerden als Rasseschicksal.“ – „Warum gibt es keine Verbindung (Nährstränge) von den Klugen zu den Dummen? Weil die Dummen emanzipiert sind, die Klugen aber nicht.“
Wilde Theorien wechseln sich in verbissener Oberstudienratsprosa mit Hirngespinsten, Pseudo-Philosophisches mit verbrämendem Schwulst ab. Nirgends nur ansatzweise Ironie, gar Selbstironie, keine Spur von Witz, Verwunderung, Neugier, Zweifel. Dünkel to go. Die Lektüre ist ein einziges Belehrtwerden, das Herrscherprinzip: Der tyrannische Autor demütigt statt mitzuteilen, diffamiert anstatt mitzufühlen. Krude, wenn er über „die wahren Obdachlosen“ doziert, nämlich Verstorbene. „Men’s oldest beast of burden was woman“, „Ältestes Lasttier des Menschen ist die Frau“, übersetzt Strauß, man beachte die Zeitform. Kein Wunder, dass er Frauen eine „Restlaufzeit“ zuschreibt. Dichterisches ist in derlei Äußerungen nur mehr Mittel zu schönfärbender Verharmlosung.
Die Grenze zur Perfidie überschreitet „Der Fortführer“, wenn das „Narrativ des Flüchtlingsdramas“ seine Entlarvung findet. Für Strauß ein Problem des Jargons: „Entweder ist es Erzählung oder Drama. Oder aber postdramatische Flüchtlingsperformance.“ Der Diskurs wird benutzt, sein notwendigerweise vorläufiges Vokabular verschnitten und desavouiert. An anderer Stelle wird vom „herrlichen Deutsch“ schwadroniert und, en passant, die Grammatik zurechtgestutzt, um anhand eines Schulfestes das Erlebnis „Unter-Menschen“ vorzuführen.
Da klappt man dann schon mal das Buch zu und ist einfach fassungslos.
Die finster-rigide „Gegenmoderne“, die Strauß propagiert, möchte man lieber nicht kennenlernen. Sie ist eine Unterwelt, eng wie ein Toaster. Den Heroen, denen er huldigt (Goethe, Novalis, George, Loerke, Pound, Benn) begegnet man besser mit kritischem Lesen. Strauß wäre gut beraten, The Clash zu hören oder Christine and the Queens. Er sollte sich von Jirō Taniguchis Mangas verblüffen lassen und hin und wieder in Christian Saalbergs Gedichten lesen. Das lässt die Superheldenkruste abplatzen.
Poesie fordert nichts, nur freies Atmen. Sie ist zu keiner Zeit Instrument, schon gar nicht der Herabwürdigung. Poesie ist das Bindegewebe menschlicher Überlieferung, doch nicht Sprache, Geschichte oder Vergangenheit stehen in der poetischen Tradierung im Vordergrund, sondern auf mannigfache Weise ist es immer menschliche Güte, sind es die Abgründe und Zweifel von Einzelnen, ob Frau oder Mann. Aus diesem Grund schrieb John Keats, Arztberuf und Dichterberuf seien dasselbe.
„Gäbe es für mich je ein Problem, würde ich sofort die Weltgemeinschaft um Rat fragen. Aber ich habe keine Probleme“, meint Botho Strauß. Man möchte ihm Leserinnen, Leser und Lasttiere wünschen, die ihn wenigstens von diesem Irrtum abbringen.
Im Jahr 2118
Liebe Linda Jahilo,
im Jahr 2118 wird meine Urururenkelin ein altes Buch aus Papier mit Gedichten ihres Urururgroßvaters zur Hand nehmen und darin lesen. Sie wird Linda heißen, so wie Sie, eigentlich aber, weil ihre Mutter, meine Ururenkelin, ihre Tochter nach einer Romanfigur von mir benannt hat – ein junges Mädchen, das in meinem Roman „Lichter als der Tag“ das Elsternkind genannt wird und das zusammen mit ihrem Vater im Musée des Beaux Arts in Lyon ein Gemälde von Camille Corot stiehlt. Linda hat nicht mehr sehr viele Bücher aus Papier in ihrem unterirdischen Wohnturm. Sie liebt aber die Stimme, die aus der Tiefe der Zeit zu ihr spricht, die Musik der Wörter, die ihr auch eine Musik der Bedeutungen zu sein scheint. Die Gedichte in dem Band, der genau 100 Jahre alt ist und ein leeres rotes Bett vor einer grünen Wand zeigt – er heißt „Wimpern und Asche“ –, bewahren für sie eine seltsame Kraft auf, eine Stärke, die sich auf sie überträgt, weshalb sie immer wieder in den Gedichten liest und sie wie einen Schatz verwahrt. Linda glaubt, den Reichtum der Welt zwischen den Zeilen hindurchleuchten zu sehen, eine Pracht, die unvergänglich ist und keinen Namen benötigt.
Avenidas
avenidas
avenidas y flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas y mujeres
avenidas y flores y mujeres y
un admirador
Eugen Gomringer
boulevards
boulevards u. blumen
blumen
blumen u. frauen
boulevards
boulevards u. frauen
boulevards u. blumen u. frauen u.
ein bewunderer
1953 / 2017
Drei Busse
 Wer ist wohl nicht alles gefahren in diesen drei Bussen, frage ich mich beim Anblick der Fotografie von Karam al-Masri, die er am 14. März 2015 in Aleppo aufnahm. Und liegen diese drei Wracks heute flach in der Straße, runtergebombt und in ihre Einzelteile zertrümmert? Auf dem Bild scheinen sie noch wenigstens gut genug dafür, um als Fluchtraketen zu taugen.
Wer ist wohl nicht alles gefahren in diesen drei Bussen, frage ich mich beim Anblick der Fotografie von Karam al-Masri, die er am 14. März 2015 in Aleppo aufnahm. Und liegen diese drei Wracks heute flach in der Straße, runtergebombt und in ihre Einzelteile zertrümmert? Auf dem Bild scheinen sie noch wenigstens gut genug dafür, um als Fluchtraketen zu taugen.
L’Europe
Nul homme n’est une île, un tout en soi; chaque homme est partie du continent, partie du large; si une parcelle de terre est emportée par les flots, pour l’Europe c’est une perte égale à celle d’un promontoire, autant qu’à celle d’un manoir de tes amis ou du tien. La mort de tout homme me diminue parce que je suis membre du genre humain. Aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi. (John Donne)
Je suis Charlie
Nach dem gestrigen Massaker in der Redaktion des Pariser Satire-Magazins „Charlie Hebdo“, bei dem die Attentäter  vier der beliebtesten französischen Karikaturisten und acht weitere Menschen getötet haben, denke ich wütend, traurig und bestürzt an den Anschlag im Sommer 2011 auf der norwegischen Insel Utøya zurück. Erinnert sei an ein Wort des damaligen norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg, das mich seinerzeit tief bewegt und getröstet hat: „Noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.“
vier der beliebtesten französischen Karikaturisten und acht weitere Menschen getötet haben, denke ich wütend, traurig und bestürzt an den Anschlag im Sommer 2011 auf der norwegischen Insel Utøya zurück. Erinnert sei an ein Wort des damaligen norwegischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg, das mich seinerzeit tief bewegt und getröstet hat: „Noch sind wir geschockt, aber wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.“
Zeichnung: Loïc Sécheresse
Lima
Die Überschwemmung von Passau,
da sie unabwendbar ist, was bringt sie
auf dem Weltklimagipfel, was trägt
sie ein? Schneller als die Alpen-
gletscher schmelzen, werden Dürren
in Australien, kalifornische Buschbrände,
Bangladeshs Überflutungen und der Untergang
des Inselreiches Tuvalu verschachert
und zu Profitmasse. Klimawandel,
Klimahandel. Ein grüner Himmel
steht über Lima am Abschlusstag
der Konferenz, so leuchtet das Meer,
und Wolken aus Staren durchrauschen
den Hafen Ancon, bei deren Anblick einer
wie Auden dächte, ein jeder sollte gleichgültig
wen lieben, oder wir alle sterben, was allerdings
Auden etwas drastisch erschien, weshalb er schrieb:
Lieben müssen wir einander und dann sterben.
Für Uli Schreiber
Bar unterm Meer
Christoph W. Bauers ganz heutige Figuren in seinen so rasanten wie profunden Erzählungen „In einer Bar unter dem Meer“ sind allesamt aus der Lebensmitte Versprengte. Von Unwirklichkeit umgeben, fühlen und denken sie wie unter Wasser. Ihr Ahnherr ist Nemo, der Kapitän von Jules Vernes Unterseeboot Nautilus, und in diesem submarinen Gefährt entdeckt Bauer ein durch Zeit und Raum gleitendes Symbol für ein mögliches Überleben durch Widerständigkeit und Fantastik. Ob jung oder alt, Frau oder Mann, jeder in diesen Geschichten ist ein Nemo, ein Niemand, der sich erinnert an das Leben außerhalb der Nautilus-Bar. In wassergleichen, mal wuchtigen, mal sanften Sätzen, die ab und an von herrlicher Süße und doch immer salzig wie geweint sind, gelingt Bauer die transparente Darstellung komplexester Wahrnehmungen unserer so fatal lieblosen Schnelllebigkeit. Nicht nur als Dichter und Chronist, auch als Erzähler erweist sich CW Bauer als eine der eigenwilligsten und markantesten Stimmen der jüngeren deutschsprachigen Literatur.
Eine Vielzahl von Ursachen
„Ein Vielzahl von Ursachen, die früheren Zeiten unbekannt waren, wirken jetzt mit vereinter Gewalt, um die Unterscheidungskräfte des Geistes abzustumpfen und ihn, indem sie ihn zu jeder spontanen Anstrengung unfähig machen, zu einem Zustand von beinah roher Stumpfheit degradieren. Die am stärksten wirksamen dieser Ursachen sind die großen nationalen Ereignisse, die sich täglich abspielen, und die zunehmende Ansammlung der Menschen in den Städten, wo die Gleichförmigkeit ihrer Beschäftigungen ein Verlangen nach außerordentlichen Vorfällen hervorruft, welches die schnelle Mitteilung von Nachrichten stündlich befriedigt.“ (William Wordsworth, Vorwort zu den „Lyrical Ballads“, 2. Ausgabe, herausgegeben mit Samuel Taylor Coleridge, Bristol 1800).
Das Unausbleibliche
„Mit Gemälden ist es oft so wie mit Frauen“, sagte Lu Xinghua während unserer gemeinsamen Lesung über Unterschiede von Bildbeschreibungen und -deutungen, „man kann stundenlang vor ihnen stehen, und nicht das Geringste passiert. Nein. Man muss ihre Gunst erlangen.“ Lu Xinghua deutet eines der derzeit meistdiskutierten Bilder Chinas, Liu Xiadongs „Out of Beichuan“, in seinem Essay „Was soll die zeitgenössische Kunst machen?“ so:  „Das Gemälde Out of Beichuan stellt die gebrochene Erde, das Überleben der Menschen und die Ungewissheit der Zukunft dar. Der zerstörte Boden bildet den Hintergrund. Zwar ist die Natur zerbrochen, doch sie ist mit ganzem Herzen gemalt. Die tote Natur ist der eigentliche Hintergrund. In Beichuan sehen wir am Kampf von Mensch und Natur, dass die Menschen und die von ihnen errichtete Welt besiegt wurden. Was macht die Darstellung einer solchen Niederlage sinnvoll? Wenn man den Boden betrachtet, gibt es dort noch Wege. Aber da ist kein Weg in die Berge mehr, nur noch ein Weg nach außen. Die Menschen sind Dämonen in einer Ecke des Bildes, eine Gruppe kranker Zombies. Der Künstler quetscht uns aus: Wo ist der Ausweg? Bereits vor dem Nahen des Lebensendes sollte man nachdenken, dazu gibt ein Erdbeben die Gelegenheit. Was die Künstler heute machen sollen, ist nicht, wie Hexen, religiöse Rituale für uns durchführen oder Feng-Shui betreiben, um uns zu helfen, der großen Katastrophe zu entgehen. Sondern sie sollen das unausbleibliche Endergebnis solcher Katastrophen in die Länge ziehen, glattbügeln und lebensecht vor die Zuschauer stellen, vielleicht sogar noch heftiger machen, sodass wir gezwungen werden, es deutlich zu sehen, damit uns die Hilflosigkeit irgendwann tapferer macht.“
„Das Gemälde Out of Beichuan stellt die gebrochene Erde, das Überleben der Menschen und die Ungewissheit der Zukunft dar. Der zerstörte Boden bildet den Hintergrund. Zwar ist die Natur zerbrochen, doch sie ist mit ganzem Herzen gemalt. Die tote Natur ist der eigentliche Hintergrund. In Beichuan sehen wir am Kampf von Mensch und Natur, dass die Menschen und die von ihnen errichtete Welt besiegt wurden. Was macht die Darstellung einer solchen Niederlage sinnvoll? Wenn man den Boden betrachtet, gibt es dort noch Wege. Aber da ist kein Weg in die Berge mehr, nur noch ein Weg nach außen. Die Menschen sind Dämonen in einer Ecke des Bildes, eine Gruppe kranker Zombies. Der Künstler quetscht uns aus: Wo ist der Ausweg? Bereits vor dem Nahen des Lebensendes sollte man nachdenken, dazu gibt ein Erdbeben die Gelegenheit. Was die Künstler heute machen sollen, ist nicht, wie Hexen, religiöse Rituale für uns durchführen oder Feng-Shui betreiben, um uns zu helfen, der großen Katastrophe zu entgehen. Sondern sie sollen das unausbleibliche Endergebnis solcher Katastrophen in die Länge ziehen, glattbügeln und lebensecht vor die Zuschauer stellen, vielleicht sogar noch heftiger machen, sodass wir gezwungen werden, es deutlich zu sehen, damit uns die Hilflosigkeit irgendwann tapferer macht.“
Foto: Liu Xiaodong, „Out of Beichuan“, Öl auf Leinwand, 300 x 400 cm (2010) © Liu Xiaodong
Umdunkelt, lausch ich
Eines der schönsten (stimmkräftigsten und filigransten) Alben  dieses oft dunklen Jahres kommt aus den Niederlanden, von The Black Atlantic aus Groningen. Nach ihrer ersten EP „Send This Home“ (2007) und dem Erstlingsalbum „Reference for Fallen Trees“ (2009) erschien im Januar „Darkling, I Listen“, eine EP mit fünf Stücken, die auf ein Zweitwerk hoffen lässt.
dieses oft dunklen Jahres kommt aus den Niederlanden, von The Black Atlantic aus Groningen. Nach ihrer ersten EP „Send This Home“ (2007) und dem Erstlingsalbum „Reference for Fallen Trees“ (2009) erschien im Januar „Darkling, I Listen“, eine EP mit fünf Stücken, die auf ein Zweitwerk hoffen lässt.
Darkling I listen? Gleich als ich den Titel zum ersten Mal las, stockte mir der Atem. „Darkling I listen“ (ohne den irritierenden Beistrich) – so beginnt die sechste Strophe von John Keats‘ „Ode to a Nightingale“, die „Ode an eine Nachtigall“, die ich vor zwanzig Jahren übersetzte:
Darkling I listen; and for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Called him soft names in many a musèd rhyme,
To take into the air my quiet breath …
Umdunkelt lausch ich; ich hab manches Mal
Mich halbwegs in den leichten Tod verguckt,
Gab ihm erträumte Namen ohne Zahl,
Damit die Luft mein ruhiges Atmen schluckt …
Stimmkräftig: Geert van der Felde singt so aus vollem Herzen, dass es einem spätestens bei „The Flooded Road (Built on Sand)“ Schauder über den Rücken jagt. Filigran: Kim Janssen, Matthijs Herder, allem voran aber das Getrommel Simon van der Heides geben „Darkling, I listen“ eine Landschaftlichkeit, die weit (tief) durch die Zeit zurückgreift (so klingen für mich die frühen Genesis herüber).
 Ehe ab 10. August die EP auch hierzulande lieferbar sein wird, lassen sich die neuen fünf Songs von The Black Atlantic u. a. auf der Seite des Haldern Pop Festivals hören: http://www.haldern-pop.de/de/label/news/tba-darkling-i-listen
Ehe ab 10. August die EP auch hierzulande lieferbar sein wird, lassen sich die neuen fünf Songs von The Black Atlantic u. a. auf der Seite des Haldern Pop Festivals hören: http://www.haldern-pop.de/de/label/news/tba-darkling-i-listen
© Albumcover: Theblackatlantic.com
© Bandporträt: rollogrady.com
Fälschung
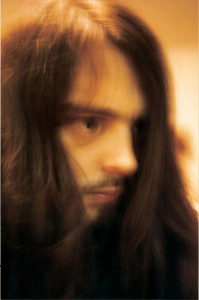
Gerhard Richter: Jonathan Meese (2012)
Öl auf Leinwand, 133 x 206 cm
Sammlung Landesbank Baden-Württemberg
Faden
Gerhard Richter auf die Frage, wie er den roten Faden in seinem malerischen Werk beschreiben würde: „Er ist rot.”



