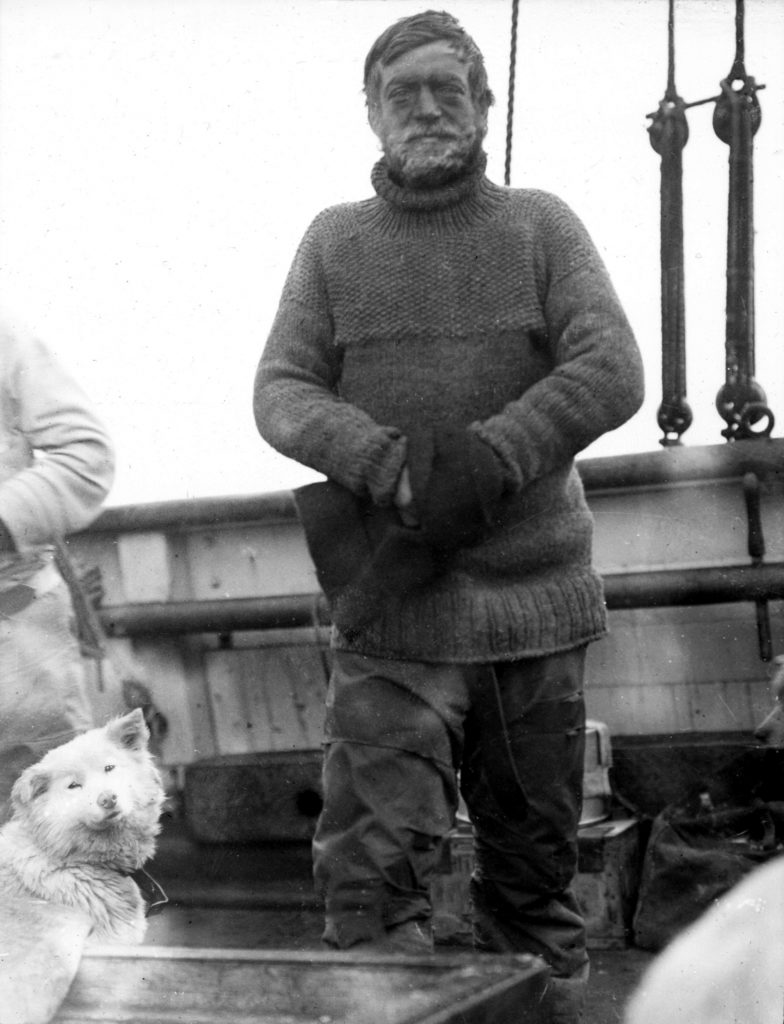Eine halbe Stunde lang fahre ich durch Industrie, Gebiete, Orte, über die die Industrie gebietet – und wo nichts anderem Raum gelassen wird. Nordenham macht kein Hehl aus dem unbedingten Willen, technologisch Anschluss zu halten – und das Alte, Überkommene als obsolet, unnötig auszumerzen. Der Bahnhof von Nordenham an der Wesermündung, an dem einst Abertausende mit Zügen aus ganz Mitteleuropa ankamen, um an Bord der Auswandererdampfer zu gehen, steht leer, ist verrammelt, abrissbereit. Am Union-Pier, dem alten Ossenpier, überkommt einen gespenstische Melancholie angesichts der ein halbes Jahrhundert jüngeren Industrieruinen wenige hundert Meter weiter flussab und der gigantischen Vergeblichkeitsanstrengungen am Bremerhavener Containerterminal am jenseitigen Ufer – dem Schrott von morgen.
Eine halbe Stunde lang fahre ich durch Industrie, Gebiete, Orte, über die die Industrie gebietet – und wo nichts anderem Raum gelassen wird. Nordenham macht kein Hehl aus dem unbedingten Willen, technologisch Anschluss zu halten – und das Alte, Überkommene als obsolet, unnötig auszumerzen. Der Bahnhof von Nordenham an der Wesermündung, an dem einst Abertausende mit Zügen aus ganz Mitteleuropa ankamen, um an Bord der Auswandererdampfer zu gehen, steht leer, ist verrammelt, abrissbereit. Am Union-Pier, dem alten Ossenpier, überkommt einen gespenstische Melancholie angesichts der ein halbes Jahrhundert jüngeren Industrieruinen wenige hundert Meter weiter flussab und der gigantischen Vergeblichkeitsanstrengungen am Bremerhavener Containerterminal am jenseitigen Ufer – dem Schrott von morgen.
Blick in eine Alleeflucht, tief, tief in die Marsch, über die das Abendlicht herströmt.
 Über den Nordenhamer Marktplatz – der wie jeder Fleck in der Stadt zerbombt und wieder aufgebaut wirkt –, rollt ein ferngesteuertes Auto, in dem nebeneinander zwei kleine Jungs sitzen und johlen. Dem Gefährt folgen ältere Geschwister der beiden kleinen Geisterfahrer, ihre Eltern und Großeltern, die Mutter mit Fernbedienung in der Hand.
Über den Nordenhamer Marktplatz – der wie jeder Fleck in der Stadt zerbombt und wieder aufgebaut wirkt –, rollt ein ferngesteuertes Auto, in dem nebeneinander zwei kleine Jungs sitzen und johlen. Dem Gefährt folgen ältere Geschwister der beiden kleinen Geisterfahrer, ihre Eltern und Großeltern, die Mutter mit Fernbedienung in der Hand.
 Der Legende nach küsste der friesische Häuptlingssohn Dude den abgeschlagenen Kopf seines Bruders Gerold. Beide wurden sie 1419 in Bremen enthauptet. Ihre Doppelhinrichtung stellt ein Fresko im Stadtmuseum Nordenham dar. Gemalt hat „Der Bruderkuss“ Hugo Zieger 1893, „Lever dod als Slav“ lautet der Titel des Freskos in anderen Quellen, „Lieber tot als ein Sklave“. Bremer Kaufleute hatten die Vredeborg im Raum Atens erbaut, auf dem Gebiet des heutigen Nordenham. Das Bollwerk richtete sich gegen Piraten, die an der Unterweser Handelsschiffe überfielen. Doch kam es zu Querelen mit den friesischen Herrschern vor Ort, den Häuptlingen. Nach einem missglückten Angriff wurden Dude und Gerold, die beiden Söhne Dide Lubbens, des Häuptlings von Stadland, im Jahr 1419 in Bremen hingerichtet. Nachfahren der friesischen Herrscherfamilie beauftragten den Kaisermaler Hugo Zieger im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts damit, die symbolträchtige Enthauptung in einem Fresko zu verewigen. Gut hundert Jahre später war das in einem historischen Bauernhaus ausgeführte Wandgemälde akut gefährdet.
Der Legende nach küsste der friesische Häuptlingssohn Dude den abgeschlagenen Kopf seines Bruders Gerold. Beide wurden sie 1419 in Bremen enthauptet. Ihre Doppelhinrichtung stellt ein Fresko im Stadtmuseum Nordenham dar. Gemalt hat „Der Bruderkuss“ Hugo Zieger 1893, „Lever dod als Slav“ lautet der Titel des Freskos in anderen Quellen, „Lieber tot als ein Sklave“. Bremer Kaufleute hatten die Vredeborg im Raum Atens erbaut, auf dem Gebiet des heutigen Nordenham. Das Bollwerk richtete sich gegen Piraten, die an der Unterweser Handelsschiffe überfielen. Doch kam es zu Querelen mit den friesischen Herrschern vor Ort, den Häuptlingen. Nach einem missglückten Angriff wurden Dude und Gerold, die beiden Söhne Dide Lubbens, des Häuptlings von Stadland, im Jahr 1419 in Bremen hingerichtet. Nachfahren der friesischen Herrscherfamilie beauftragten den Kaisermaler Hugo Zieger im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts damit, die symbolträchtige Enthauptung in einem Fresko zu verewigen. Gut hundert Jahre später war das in einem historischen Bauernhaus ausgeführte Wandgemälde akut gefährdet.  Der Leiter des Nordenhamer Stadtmuseums Timothy Saunders erzählt von der aufwändigen Restaurierung, dass ein Firnis aufgetragen, dann Tuch aufgeklebt, darauf Holzbretter geklebt wurden. Von der anderen Seite der Wand habe man den Putz abgeschlagen, die Steine ausgesägt und einzeln aus der Wand gebrochen, bis einzig die mit dem Fresko bemalte Putzschicht übriggeblieben sei, geklebt auf Holzplatten. Um sie habe man herumsägen und das Fresko in drei Teilen aus dem Haus tragen können. Von Liebe kein Wort. Der Liebe eines jungen Mannes zu seinem Bruder. Dem Anblick des abgeschlagenen Kopfes. Den lauter Köpfen, die Zieger malte in Anbetracht des historischen, über vier Jahrhunderte lang vergangenen Geschehens. Abgeschlagen der Kopf, abgeschlagen das Bild.
Der Leiter des Nordenhamer Stadtmuseums Timothy Saunders erzählt von der aufwändigen Restaurierung, dass ein Firnis aufgetragen, dann Tuch aufgeklebt, darauf Holzbretter geklebt wurden. Von der anderen Seite der Wand habe man den Putz abgeschlagen, die Steine ausgesägt und einzeln aus der Wand gebrochen, bis einzig die mit dem Fresko bemalte Putzschicht übriggeblieben sei, geklebt auf Holzplatten. Um sie habe man herumsägen und das Fresko in drei Teilen aus dem Haus tragen können. Von Liebe kein Wort. Der Liebe eines jungen Mannes zu seinem Bruder. Dem Anblick des abgeschlagenen Kopfes. Den lauter Köpfen, die Zieger malte in Anbetracht des historischen, über vier Jahrhunderte lang vergangenen Geschehens. Abgeschlagen der Kopf, abgeschlagen das Bild.