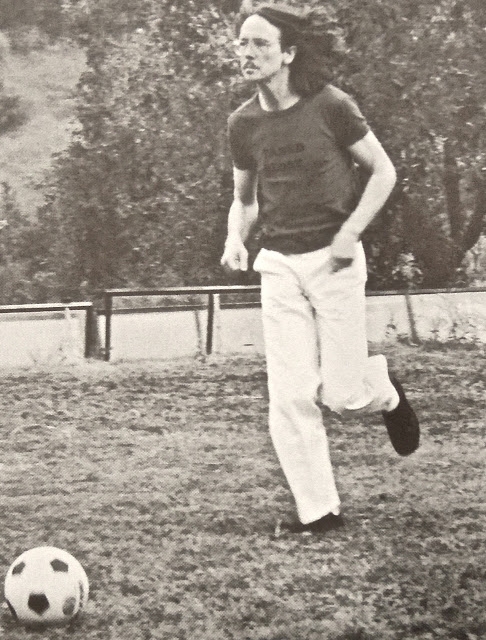Denk zurück an den Tunnel von Vereina. 22 Kilometer lang Dunkelheit, zusammen auf dem Rücksitz des Autos mit einem Dichterfreund, dem die Angst durch den Leib steigt. Der Autozug donnerte durch den Berg, und ich dachte, glücklich, das erleben zu können, an Peter Handkes „Die Wiederholung“, wo Filip Kobal durch genau so einen, nur etwas weiter östlichen Tunnel läuft, von Kärnten nach Slowenien, nicht Südtirol in Richtung Liechtenstein, und sich müde in eine Nische zum Schlafen niederlegt. Jedes Ding in der Nische erzählt ihm von sich. Krachend braust ein Zug an ihm vorbei, keinen Meter entfernt der Lärm des Lebens. Handke überträgt die unvergessliche Szene – oder hat sie deshalb überhaupt erdacht, vielleicht erträumt – auf sein Schreiben, den eigenen Tunnelblick dessen, der erzählt: „mein einziger Weg zu einer Menschheit ist es, den Dingen des stummen Planeten, dessen Häftling ich, Erzähler sein wollend – selber schuld! –, bin, die Augen eines mich begnadigenden Worts einzusetzen.“
Auf dem Bahnsteig sitzt in sich versunken ein Einarmiger und wirkt verzweifelt. In seiner Hand ein Beutel Tabak, „Samson“. Während es zu nieseln beginnt, dreht er sich unter dem Bahnsteigdach einhändig eine Zigarette. Nur ein einziges Mal in 33 Jahren Rauchen ist dir das gelungen.
Cos-Player: Versuch, die eigene Lieblingsfigur (die in ihrer Unwirklichkeit gefangen ist) nicht nur selber darzustellen, sondern mit Leben zu erfüllen. (4.7.)
Tiersinn – an der Dicke des Bluts dessen Süße zu erkennen.
Morgen die Abiturfeier deines Sohnes. Weißt du noch, seine bange Frage irgendwann, an deiner Hand: „Hat eigentlich jeder, ich meine wirklich jeder, in sich drin ein Sklett?“
„Jedes Arschloch ist anders“, sagt die fette Frau im Zug zu ihren Freunden, alle vier offenbar Mediziner. Sie erzählt von ihren ganz erstaunlichen Erlebnissen mit Paketkurieren und beim Einkauf. Ja, jedes Arschloch ist anders, schon anatomisch, Frau Doktor, aber auch jedes Antlitz. (Wittenberge, 9. Juli)
Wenn du künftig schwimmen gehst in der Ostsee, wirst du da nicht auch in der Asche deines Vaters baden?
Am Morgen nach dem Streit, bevor du das so elende wie triumphale Streitross deines Körpers aus dem Bett hievst, bringen sich die Worthülsen und Redewendungen in Stellung, die dir seit Jahrzehnten jedes Sprechen, jeden wirklichen Austausch verunmöglichen. Erbärmlicher Knecht.
„And I am so sensitive that I seem to be insane; even the stars in heaven discountenance me.“ John Cheever