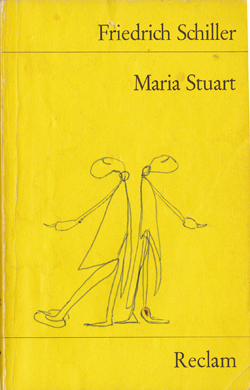„Wegrationalisieren“ – im Grunde ein schöner, sprechender Ausdruck. Er verrät die Angst, als irrational dazustehen, weshalb man sich als einzig vernünftig ausgibt. Zu Anmaßung und Unmäßigkeit der Vernunft schreibt Albert Camus: „Das griechische Denken wurde immer durch die Vorstellung der Grenze aufgehalten. Nichts wurde bis zum Ende fortgetrieben, weder das Heilige noch die Vernunft, weil es nie etwas leugnete, weder das Heilige noch die Vernunft. Den Schatten durch das Licht ins Gleichgewicht bringend, hat es vielmehr alles einbezogen. In die Eroberung der Totalität geschleudert, ist unser Europa dagegen die Tochter der Unmäßigkeit. Es leugnet die Schönheit, wie es alles leugnet, was es nicht anbetet. Und sei es auch auf verschiedene Weise, betet es nur das eine an, nämlich den künftigen Sieg der Vernunft. In seinem Wahn versetzt es die ewigen Grenzen, und düstere Erinnerungen stürzen sich in diesem Augenblick darauf und zerreißen es. Nemesis, die Göttin des Maßes, nicht der Rache, wacht. Wer immer die Grenzen überschreitet, wird unerbittlich von ihr gestraft.“ – Camus zeichnet in „Helenas Exil“ (1948) eigentlich nicht den Missgriff der Vernunft nach, sondern vielmehr die Maskierung der Unvernunft mit dem Flitter der Ratio. Unterm Deckmantel der Vernunft mogeln sich Angst und Abscheu eine Welt hin, die das Alte und das Schöne verdammt, indem es das eine wegrationalisiert und das andere zu Tode bagatellisiert.