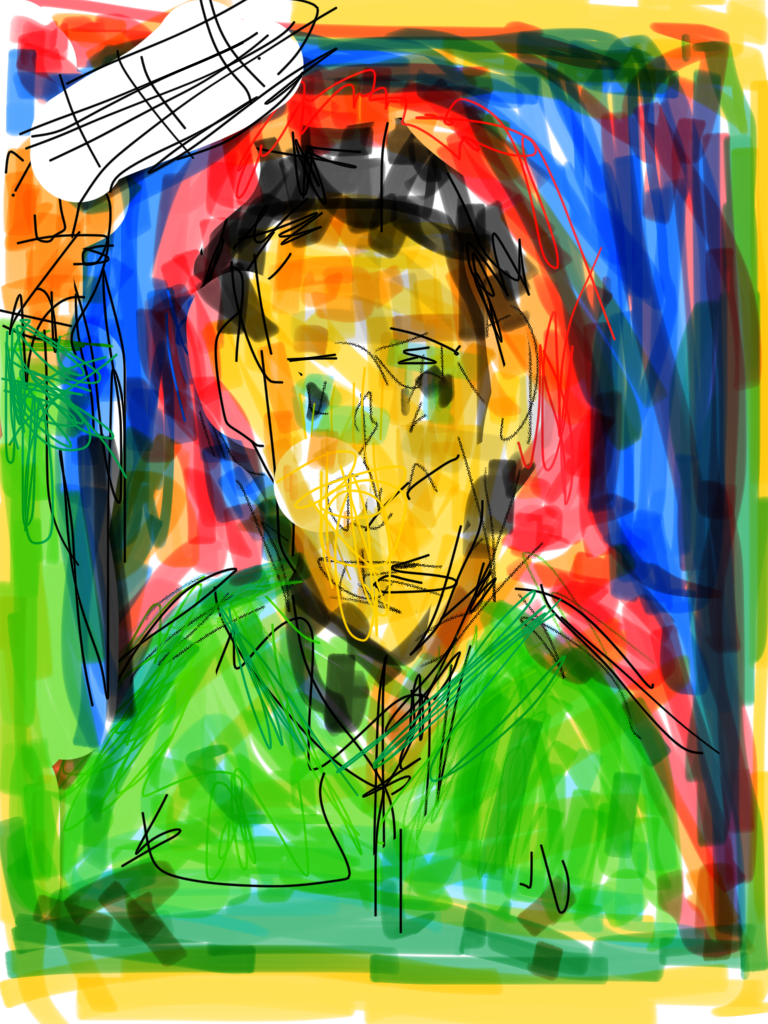Archiv für den Monat Juni 2017
Cafarde
Der us-amerikanische Fake-Präsident Tronald Dump hat mit FBI-Chef Cames Jomey den Mann entlassen, der die Verstrickungen des Milliardärs und Tycoons in Wahlmanipulationen durch Putinistan untersuchte. Die Vereinigten Staaten von Trumponesien scheinen selbst diesen Frontalangriff auf die Demokratie hinzunehmen, als ginge es um den Verkauf einer unrentablen Supermarktkette: LINCOLNMART. Der Supreme Court sollte stattdessen beraten, ob hier nicht eine Clique die Verfassung aushöhlt, und darauf ein unmissverständliches Zeichen für die Wehrhaftigkeit der pluralistischen Rechtsgesellschaft setzen.
Der Mann, der mir den lahmen Flügel zu neuem Leben zu erwecken versucht, sagt: „Es gibt Tage, da wacht man morgens auf und ist kein Mensch.“ Ein Satz wie von John Cheever. Der sagt von sich, am Morgen nach einer durchsoffenen Nacht werde er verfolgt von „the cafarde“ – ein Begriff, der in diesem Kontext auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt. Das englische „cafard“ bezeichnet eine hartnäckige Deprimiertheit, zugleich aber ist es der gängige Ausdruck für die Kakerlake. Cheever schreibt: „The cafarde always followed. It was never waiting for him at his destination.“ Dass hier nicht allein eine kafkaeske Küchenschabe gemeint ist, in die der Trinker sich verwandelt sieht, macht Cheever deutlich, wenn er schreibt: „Reading old journals, I find that the booze fight and the cafarde have been going on for longer than I knew.“ Warum schreibt er beharrlich cafard falsch und setzt das Wort kursiv? Das französische „cafarde“ meint eine Petze, nicht aber die Schabe (die Suffschabe) oder den „Kater“. Cafard – etymologisch verwandt mit dem Käfer? Im Internet wird aus „cafarde“ stillschweigend ein (vermeintlich) verständlicheres „cafard“. Cheever scheint dagegen nach einem passenden Bild für einen nicht zu beschreibenden Zustand zu suchen – „das schwarze Viech“: „The cafarde, and how mysterious it is in its resistance to good fortune, love of all kinds, esteem, work, blue sky. I try to console myself with thinking of all the great men who have suffered similarly; but reason has no effect on the bête noire. It could quite simply be alcohol, since alcohol is the sure cure.“
So eine Gerbera im Glas, die dort den ganzen Tag lang auf dem Tisch steht, weil ein Draht sie stützt, der sie umwickelt und in die Höhe läuft, wo er in ihrem Kopf steckt, so eine Gerbera war ich länger als zwei Drittel meines Lebens.
Das französische „vrai“ und das deutsche „frei“ – sind sie verwandt? Ja. Spätestens seit jetzt, wie wahr, ich bin so frei.
Unter dem einzigen Baum auf der ganzen großen Wiese, sattgrün voller hohem Gras, lagert die Clique im Schatten und schert sich was um die Leute, die in sicherer Entfernung (hinter den Zäunen) um sie herumgehen. Man döst, schläft. Nur selten hebt einer den Kopf und sieht nach, wie weit der Tag vorangeschritten ist. Und kaum ist die Sonne hinter den Rotbuchen verschwunden, stehen sie alle auf und trotten hinüber zum sattesten Kleegras. (Tambach, 17.5.)
Räder
Kindheit. Und Kindheit
Jeder, der ihn besser kennt, weiß: Er kann mit Händen Fliegen fangen. Er öffnet ein Fenster, und wie die eigene Faust wirft er die gefangene und zugleich gerettete Fliege hinaus, ins Freie. Für ihn ist dieses Talent keine Fähigkeit, keine Frage von Schnelligkeit. Er sagt, er versetze sich in die Lage der Fliege. Sie staunt. Sie ist vergesslich. Er zögert einen Moment lang den Zugriff, den Fang hinaus … damit rechnet die Fliege nicht. Womit rechnet sie? Immer frei zu sein. Immer zu leben? Die Fliege rechnet mit gar nichts. Sie lebt. Sie fliegt. Sie fliegt hinaus.
Du kannst ein Buch vom ersten Satz an lieben und von ihm wissen, dass es ein dein Leben veränderndes sein wird. Woran liegt das? Am sogenannten Inhalt oder, noch schlimmer, am „Plot“ – oh Gott – ? Pffff … Es liegt einzig am Zweifel. Der Zweifel spricht aus allen Dingen und Wörtern bei Wolfram von Eschenbachs Auftakt zum „Parzival“, noch in der Prosaübertragung durch Wolfgang Spiewok: „Ist Unentschiedenheit dem Herzen nah, so muß der Seele daraus Bitterkeit erwachsen. Verbindet sich – wie in den zwei Farben der Elster – unverzagter Mannesmut mit seinem Gegenteil, so ist alles rühmlich und schmachvoll zugleich. Wer schwankt, kann immer noch froh sein; denn Himmel und Hölle haben an ihm Anteil. Wer allerdings den inneren Halt völlig verliert, der ist ganz schwarzfarben und endet schließlich in der Finsternis der Hölle. Wer dagegen innere Festigkeit bewahrt, der hält sich an die lichte Farbe des Himmels.“
Kindheit: Warmer Frühlingswind bringt warmen Frühlingsregen, trägt ihn vor sich her, bis der Regen zunimmt und den Wind löscht. Dazu duften in den Auen die Blüten der weißen Uferpflanzen.
Und Kindheit: Du spürtest den Regen weniger auf der Haut, als dass du ihn sehen konntest – nicht wie er vom Himmel fiel, sondern als silbernes Punktesystem auf dem Wasser. Der Fluss brachte den Regen.
Mit grüner Jacke und Lampe
Die Norm
Stärker als aller Mut, alle Liebe und jede Solidarität scheint die Angst vorm Versagen der Norm zu sein, vorm Abbröckeln und Zerbröckeln der Normalität. – Der junge Mann in der U-Bahn zur Touristenmeile am Hafen, dessen aufscheinende Abgerissenheit ihn entlarvt (als nicht zu UNS gehörig), welche Gefahr stellt er dar? Die größte. Er gibt vor, zu telefonieren, obwohl sein Handy (uralt) offensichtlich defekt ist. Was hat er vor? Das Schlimmste. Er steht am Rand zum Absurden. Er kündet von der Vergeblichkeit aller Absicherung – technologischer, gesundheitlicher, moralischer, zwischenmenschlicher. Vielleicht ist er Jesus Christus. Er hat so einen meschuggen Blick. Nicht ganz bei Trost. Gefährlich. Wir werden alles verlieren, und nichts auf der Welt und niemand im Himmel kann das verhindern. Die einzige Chance (das ertragen zu lernen) besteht darin, die Norm zu durchschauen – Kunst – und Widerstand zu leisten gegen ihre Tyrannen und willigen Helfer, gegen ihren zerstörerischen Zwang zu Verblödung und Vereinsamung: Miteinander. (Landungsbrücken, 1. Mai)
Das Duschwasser duftet. Am Frühstückstisch lässt die philippinische Bedienung eine silberne Kugel an einem Stab auf dein Ei niedersausen, woraufhin die Schale in genau der Weise aufplatzt, die ein Eikochbuch vorschreibt. Krack. „Grüezi“, sagt das Gesicht lächelnd. (Zürich, 3.5.)
Such das Gespräch in der fremden Stadt mit denen, die hier leben: Die meisten von ihnen sind Gespenster. Such das Gespräch in der fremden Stadt mit dem, was hier lebt – dem Fluss, den Parks, den Gärten und Wegen. Der Geschichte. Bayern. Deiner Kindheit. Sie erkennen dich wieder. Nichts in Bayern, niemand vergisst etwas. Wenig weiß man von außerhalb, aber kaum etwas vergisst man hier. Lass nicht nach, das Gespräch zu suchen mit den fränkischen Gespenstern dieser Stadt. (5.5.)
Im Antiquariat eine halbe Seite des PARZIVAL gelesen – den ganzen Tag gerettet. Wodurch, womit? Die Antwort darauf halte geheim.
Reise durch die Schneeschmelze
Vielfach unterschätzt, beiseite gewischt und verspottet, zuschanden gelesen, dabei unverändert in sich ruhend, ein wirklicher Dichter, unabhängig, abhold jeder Manier und Fremdbestimmung: Jean-Louis Lebris de Kérouac, der sich Jack Kerouac nannte. Verkannt sogar von seinen Mitstreitern und Weggefährten. Ich las „On the Road“ mit Anfang 20 und habe noch immer das Kerouac-Gefühl im Herzen. Ich hörte die Go Betweens, ihre Hymne The House Jack Kerouac Built. Kerouacs „American Haikus“, die sich dem japanischen Korsett verweigern, würde ich gern übersetzen, aber kann es mir nicht leisten. Vielleicht grad deshalb sollte ich es machen!
Läuft auf dem Nachhauseweg
quer über den Bolzplatz,
der einsame Geschäftsmann
Vor der Pfarrkirche herrscht jeden Sonntagvormittag Parkplatznot.
Die Kinder, alle drei, die wilden Blumen, die umhertoben, die uns das Leben lebendig machen, haben am selben Tag Geburtstag wie Shakespeare und wie Cervantes. (23.4.)
Heute endlich einmal wieder mit deiner Lieblingsbaumreihe geskypt.
Noch Stunden nach dem Fotoshooting hing das Aftershave des Fotografen im Treppenhaus wie eine Duftwolke.
Als er sich zum ersten Mal – aus einer Laune heraus – das Stadtpalais, in dem er seit kurzem wohnte, von außen besah, fiel ihm das aufgemalte Barockfenster an der Seitenwand auf, hinter der er schlief.
In einem Schacht an einer Straßenecke der Altstadt plätschert es unablässig. Ein dutzend Stufen führen hinab zu dem aufgewühlten, schön perlenden Wasser, in das unter dem Pflaster hindurch ein Rohr läuft: der Bamberger Leschen-Brunnen, von 1554.
Aus der Brasserieküche dringt lautes Klatschen auf den Platz hinaus, an dem Hegel ein Jahr lang wohnte und im „Haus zum Krebs“ die „Phänomenologie des Geistes“ schrieb – der indonesische Pizzabäcker ist zurück.
Ulm. Reise durch die Schneeschmelze. (27.4.)
Immer ein besonderer Glanz (im Licht und auf dem Gemüt): Gras zwischen den Bahngleisen.