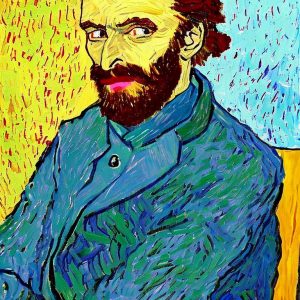Das Gras
Die Dinge – hä? – the things?
Wer immer hier im Gras herumliest – bitte nicht vergessen, dass diese Einträge ursprünglich handschriftliche Notate sind, notiert in mein Notizbuch, plötzlich, überfallartig, nicht selten zu unmöglicher Zeit und noch seltener aus der Erinnerung. Das bringt es mit sich, dass die Zeit sich dehnt. Ich erinnere mich an die Anfänge des Grases vor elf Jahren, als ich schon einen Verzug zwischen Niederschrift und Posting von einem Monat als eklatant empfand. Eklatant? Ja. Der Verzug machte etwas mit mir, veränderte meinen Blick auf die vermeintliche Aktualität meines Schreibens. Der Verzug verzog mein Schreiben, verrückte es – ganz als würde das Gras über Nacht um einen halben Meter gewachsen sein. Diesen Verzug habe ich kultiviert. Er beträgt derzeit acht Monate. Er hat schon einmal anderthalb Jahre betragen! Das Gras wächst nach seinen eigenen Maßstäben, den Umständen (meines Lebens) entsprechend. Aktualität ist Sache des Grases nicht. Und das … ist kein Grund zur Entschuldigung.
O die Süße der Stille. Und erst deiner Haut. (12/4/23)
Jeder Hund, der dir entgegenkommt, hält die Einkaufstasche, die du trägst, zunächst für einen Hund. Und du, nach der Begegnung – wofür hältst du deine Tasche? Und wofür den Hund?
In Schrittgeschwindigkeit fährt ein junger Mann auf einem E-Roller neben seinem Freund her und unterhält sich dabei mit ihm – eine völlig neue Weltsituation.
Es bleibt keine Verbitterung, nur die Freude angesichts des Vergangenen. Ich habe immer geliebt, gestaunt und mich gewundert, die Bitterkeit soll zum Teufel gehen. Haben solche Sätze noch irgendwelche Aussagekraft? Sie müssen. Ein Zurück gibt es nicht, es sei denn in den Lektüren – und auch dort nur der Anschauung halber.
Neben dem Porsche leuchtet in der Nacht ein Lichtpfad auf: zur Heckklappe! Als sein Eigentümer die Klappe schließt – der Wagen schließt sie für ihn –, erlischt der Pfad, und in der Straße wird es dunkel.
Genesis – And then there were three …
Genesis – Wind & wuthering
Genesis – A trick of the tail
Jeder Krieg ist ein Messer, ein Gradmesser. Er zeigt an, wozu wir Menschen imstande sind, hier und jetzt – und wovon wir abgehalten werden allein durch die glücklichen Umstände, in denen wir leben.
Dir müssen die älteren Jahre zu denken geben – du hast dich, seit du Kind warst, darauf vorbereitet. Okay, die Entwicklungen überraschen dich. Die Wiederkehr des Politischen in seiner Vehemenz. Aber gut, sie wollen es so, oder? Again the Stumpfsinn. So vieles wäre möglich zurzeit!
Wilde ist wirklich, Oscar is real, wirklich auch als Spiegel unserer Zeit. Ihre unfassbare Dekadenz und damit einhergehend ihre vor sich her getragene Fühligkeit. Keinen Augenblick lang glaube ich einem oder einer von ihnen, es gehe um „die Natur“, „die Welt“ oder „Umwelt“. Du erkennst die Leute an ihrer Sprache – und ihrem Schuhwerk.
Natürlich, die Dinge – hä? – the things? – müssen sich ändern. Ist das nicht ihre Aufgabe? So geht es ja nicht weiter, schon deshalb nicht, weil die Jungen aufbegehren, zu recht. Nur ist da Maß gefordert, Umsicht, Gerechtsein. Es sollte, stünde es zur Wahl, die Welt hingegeben werden, um die Alten ebenso zu verteidigen wie die Kinder. Ja, an diesem Punkt bin ich bei Wordsworth, wenn er sagt: that we have all of us one human heart.
Vincent in Volx
Die Jahreszeit des Kummers
Ich überhole eine junge Frau, die in diesem Moment in ihr Telefon sagt: „Mittwochabend gehört uns die Welt!“
„Der dritte Tag am Meer! Der dritte Tag am Meer!“, ruft das Kind, als es am frühen Morgen, mitten in der Stadt, aus dem Haus kommt, gefolgt von seiner Mutter, die es anherrscht: „Hör auf! Hör auf! Das ist unsinnig!“
The Walkmen – You & me
Bevor es anfängt zu regnen, das leise Gerassel der letzten, schon angegilbten Herbstblätter in den Platanenkronen. Sie imitieren den Regen, der folgt.
Barclay James Harvest – Everyone ist everybody else
Everything but the girl – Eden
In der abendlichen S-Bahn hinaus an den Stadtrand zu einem fernen Freund schläft ein Mann und kann von drei Bahnangestellten (SECURITY) nicht geweckt werden – weswegen der Zug nicht geleert und nicht ausgesetzt und weswegen der Nachfolgezug in den Bahnhof nicht einfahren und daher nicht bestiegen werden kann. Der Mann ist der einzige Mensch, der noch in dem Zug sitzt. Es ist jetzt sein Zug. Es ist sein Schlafzug. Der schlafende Mann weiß nicht und ahnt nicht mal, dass der Zug verlassen werden soll, damit er ausgesetzt werden kann, er weiß nicht und ahnt oder befürchtet nicht, dreißig oder fünfzig oder hundert Menschen könnten dadurch, dass er schläft, in der Schneekälte auf dem Bahnsteig zu warten gezwungen sein. Er schläft, er träumt, er fährt. In jedem Augenblick des Lebens besteht die Möglichkeit zur Poesie und somit zum Wunder. Eine Lautsprecherstimme aus der Dunkelheit gibt bekannt, dass der Zug mit dem Schlafenden, der nicht geweckt werden kann, erneut bestiegen werden und außerfahrplanmäßig seine Fahrt fortsetzen soll. Ich steige wieder in den Zug des Träumers. (Ohlsdorf, 15.12.)
Grizzly Bear – Shields
Spoon – They want my soul
Grizzly Bear – Veckatimest
Raoul Dufy muss sein Bild von der Promenade des Anglais in Nizza an einem Fenster im Hotel Suisse gemalt haben – nur von dort geht der Blick so über Strand und Bucht. 1922 begann James Joyce in dem Hotel „Finnegans Wake“ zu schreiben und dürfte gleichfalls ein Zimmer mit Meerblick gehabt haben – dasselbe. (Nizza, 7.2.23)
Taylor Swift – Midnights
480 Finger flehend zum Himmel gereckt – der winterkahle Feigenbaum. (Volx, 9.2.)
Der Sommer ein Jahr.
Die Jahreszeit des Kummers.
Jeder Träumende wird immerzu aufgefordert zu handeln.
Keith Jarrett – Bordeaux Concert
Blumendüfte, Worte einer anderen Welt.
Gib es zu: Du bist an dein Ende gekommen. Aber das Ende, wie wunderbar: Am Ende des Schreibens steht immer der Anfang von Nachdenken über dich und die Zusammenhänge. Es gibt nichts, was unerwähnt bleiben sollte, hörst du? Nichts. Erschreckend ist an dieser Zeit nichts, nur dein Zögern.
David Crosby – If I could only remember my name
Der Regen aus Milch
Utopie
אוטופיה
״זוכרת איך זה היה פעם,
כשהשמש מילאה את השמיים?
… הימים האלה לא ייגמרו לעולם.״
רוברט סמית
הַבִּיטִי, הַשַּׁחַר
חוֹשֵׂף אֶת הָעִיר מִן הַלַּיְלָה
בְּרוּחוֹת קַלּוֹת,
בִּזְהִירוּת אַרְכִיאוֹלוֹגִית מֻפְלֶגֶת.
שְׁלוּלִיּוֹת עֲכוּרוּת עוֹלוֹת אֶל הָאוֹר
בְּשִׁירוֹ.
וְשֶׁלֶג, מַבּוּל מִתְפּוֹצֵץ שֶׁל רךְֹ.
זִמְרָתָן הַפְּרוּצָה שֶׁל הַצִּפֳּרִים מְנַבֵּאת
בְּקָרוֹב תִּתְפַּתַּח שֶׁמֶשׁ חֲדָשָׁה,
לֹא כֶּתֶם בַּעֲרָפֶל כְּמוֹ
טְלַאי מְכעָֹר.
מִישׁוֹרֵי הַפְּרִיחָה וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה לֹא יִגָּמְרוּ לְעוֹלָם.
מִי שֶׁרָצִינוּ לִהְיוֹת,
הַשָּׁנִים הַמִּתְאַמְּצוֹת אֶל אֵיזֶה סוֹף,
מֵתוּ.
עַכְשָׁו אֲנַחְנוּ יְלָדִים.
„Weißt du noch damals wie es war
als die Sonne den ganzen Himmel ausfüllte
… diese Tage hörten nie auf.“
Robert Smith
Schau, die Dämmerung,
mit archäologischer Sorgfalt
schält sie bei leichtem Wind
die Stadt aus der Nacht.
Pfützen steigen ins Licht,
sein Gedicht.
Und Schnee, eine sachte Sturzflut.
Der brüchige Vogelgesang prophezeit
das Anwachsen einer neuen Sonne,
kein Nebelfleck wie
ein hässlicher Aufnäher.
Die blühenden Weiten und diese Tage hören nie auf.
Die wir sein wollten,
einem Ende entgegenstrebende Jahre,
sind gestorben.
Jetzt sind wir Kinder.
Shimon Adaf
(Aus dem Hebräischen von Mirko Bonné)
White trash
Nicht zu verachten
Nicht zu verachten: wie morgens das Licht gekrochen kommt und hausieren geht.
Ich denke an Rio zurück. Ich denke an die grünen Wogen, die hereinbrandeten an den Strand von Ipanema und daran, wie es war, dort allein zu gehen, vormittags, in der minütlich zunehmenden Sonnenwärme, den Tag vor mir, im Bauch Mango und Papaya, vor Augen die Meeresweite und auf der Haut den warmen Salzwind. Daran denke ich zuerst, wenn ich zurückdenke an Rio, die Wochen dort in Ipanema. Ich denke an die Termiten in meinem Schlafzimmerschrank. Ich denke an den Jungen, der nur noch ein Crackgerippe war und mir entgegengewankt kam auf der Straße, ein lebender Toter mit unfassbar traurigem Blick. An die Affen denke ich, in den Bäumen neugierig rufend, und wie sie am Abend zurückkletterten von Ast zu Ast hinauf in die Urwaldbäume kilometerweit. An die Musik aus den Favelas unterhalb meines Wohnturms. An die großen Brecher, die hereinrollten über die See und zu sehen waren in Kilometerferne. Mit einem Mal aber fällt mir die Fähre nach Niteroi wieder ein – zum ersten Mal in dieser Intensität: der riesige Schiffsrumpf, der sich heranschiebt an den Anleger, und Tausende von Passieren, die an Land strömen, die Tausende, die an Bord strömen, als wären sie dieselben und würden immer hin und her pendeln zwischen den Schwesterstädten. Einer davon ich. Und das schwere Stampfen der Maschine, der warme Andrang der Leute, das Lachen und das innehaltende Blicken auf die Bucht, während wir (wir) übersetzen. – Warum fällt mir das zwölf Jahre später mit einem Mal so deutlich wieder ein? (28.8.)
Nicht zu verachten: die Erfüllung der Tauben, sobald zwei der Biester einander gefunden haben.
Die Tresenkellnerin nimmt einen Apfel aus einer Schublade voller Äpfel. Lächelnd zerschreddert sie ihn im Entsafter.
Das Reich der Zerrüttung.
Cocteau Twins – Blue bell knoll
Nicht zu verachten: das Non-Hodgkin-Lymphom.
In der nächtlichen Gasse zur Piazza Navona kommt dir ein Zentaur entgegen. Das Mädchen mit der langen schwarzen Mähne sitzt auf den Schultern ihres Freundes, und es lächelt über dein Staunen. (Rom, 27.9.)
Als nach vier Tagen die Lesereise durch die Pfalz mit sechs Dichterinnen und Dichtern aus Israel endet, bin ich nicht mehr so bekümmert wie früher nach dem Ende solcher intensiver Tage voll des Austauschs und Kennenlernens einer erfüllten (ja) Fremde. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz möchte ich mit jedem Menschen sofort reden. Alle Fremden scheinen Hebräisch zu sprechen, und wie zauberhaft das klingt. (12.10.)
Und wie unbehaust und verloren du dir vorkommst, als der Zug ohne dich, aber mit deinem Gepäck abfährt.
Und Hass mag Folge sein, Antwort ist er nicht. Hass ist das Ende, das Aus jeder Antwort oder Erwiderung, die Kapitulation vor dem Kontaktabbruch – was kein Ausdruck ist, sondern hässliche Beschönigung. Hass sagt nichts, weiß nichts, ist nichts als nur er selbst. Hass ist das schwarze irre Kreiseln in dich selbst, ohne je wieder aus dir hinaus ins Andere zu finden – ist nur mehr Hassen. Ist nichts, nichts als Hass.
Get well soon – Vexations
Get well soon – Rest now, weary head! You will get well soon
Hauke Harder – Painted cakes are real, too
Nicht zu verachten: Kein Buch, das – zu verschenken! – auf den Altpapiercontainer gelegt wird, bleibt liegen.
Reading
Der Innenhof
Pünktlich wie der Perseidenregen
Sieben rote Löschflugzeuge kommen aus südlicher Richtung über die Durance und halten auf den schweren Waldbrand im äußerst östlichen Luberonausläufer zu. Vom Badesee aus sieht man den Qualm in kilometerhohen Pilzen in den Himmel steigen, schließlich auch die Flammen, die lodernden Bäume, auf die das Feuer springt. Wir schwimmen, und der Himmel über den Dörfern am Gebirgsrand färbt sich grau. Die Canadair-Flugzeuge sind rot, das Wasser, das sie abwerfen, wirkt aus der Ferne tropfengroß. (5.8.)
Mit den Schatten kommen die Vögel.
Die sogenannte „Tibet-Entdeckerin“ Alexandra David-Néel ließ sich nach ihrer 13 Jahre dauernden Rundreise durch den Fernen Osten in Digne-les-bains nieder, weil ihr Mann nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Fortan lebte Néel mit ihrem tibetischen Adoptivsohn in der Vallée des eaux froids, im Kaltwassertal zwischen den provençalischen Alpen und den im Sommer vertrockneten Flüssen Durance und Bléone. In Digne wurde sie 101 Jahre alt, machte mit 78 noch den Führerschein und ließ ihren Reisepass kurz vor ihrem Tod verlängern. Reisen bedeutet nach Alexandra David-Néel, den Tod kennenzulernen, ja ihn zu erlernen (apprendre le mort) – ganz in Hamlets Sinn: In der großen Fremde bereitest du dich vor auf die Reise in das Land, aus dem nie jemand wiederkehrt. (Digne-les-bains, 7.8.)
Der Schwindel auf der letzten Brücke über den Abgrund.
Die Grausamkeit auf der hochsommerlichen Terrasse! Auf dem Tisch unterm Feigenbaum liegt ein abgetrennter Wespenkopf, in den toten Augen keinerlei Erstaunen. Als aus dem Geräteschuppen eine Motte herausstürzt, wirft sich eine Wespe auf sie, zwingt sie zu Boden, und lähmt sie binnen eines Augenblicks. Zwei Hornissen beißen einander kreiselnd auf dem Beton so lange, bis eine ermattet aufgibt und verendet. Minuten später ist von ihrem Kadaver nichts mehr übrig. Die Ameisen feiern ein Hornissenfest. (Forcalquier, 15.8.)
Was du dir vorgenommen hast, bring zu Ende, zumal wenn es das Nichtscheitern ist – nur so wirst du nicht gescheitert sein.
Mit der Motorsäge gegen ein Hornissennest.
Noch immer pünktlich wie der Perseidenregen: die großen Sommergewitter Mitte August, Garanten, dass das Leben weitergeht.
Was wie ein fortwährendes Zusammenstoßen auf der Ameisenstraße anmutet, ist konsequenter Austausch: Jedes dem Hauptstrom entgegenrennende Tier hält für einen Sekundenbruchteil vor dem ersten in die andere Richtung krabbelnden inne und scheint etwas von ihm zu übernehmen – ein unsichtbares Etwas, eine Bestätigung, ein Kommando, ein Ameisenwort. (Volx, 16.8.)
Es gebe Augustgewitter, sagt mein Herz, die über dem Dorf kreisen und bis zu drei Mal wiederkehren, um ihren Regen abzuliefern.
„Der Tod hat dich uns genommen, aber nicht deine Lebensfreude“ – das in Stein gerahmte Foto auf dem Grab des 22-Jährigen zeigt ihn auf seiner Kawasaki.
Die todkranke Katze wird von Artgenossen und Menschen gemieden und meidet Katzen und Leute ebenso. Sie stirbt unter den Lebenden, wird achtsam toleriert und begleitet, bis sie fehlt und Erinnerung ist. (Banon, August.)
Feuilleton
Boy et fille
Die Ameisen
Sie begrüßen jede Pore
im Beton, und sie wissen,
die Süße der Feigen hängt
vom Wind ab, davon, wie
heiß er weht ab Mitte Juli.
Sie durchqueren Wand und
Haus, lesen sich durch die
Dachzimmer und deine und
meine Erinnerungen, deren
Königinnen sie gut kennen.
Rennende Buchstaben und
schwarze Küsse wie Bisse,
rieseln sie über den Horizont
der Brüstung, Mischung aus
Regen, Ast, Lakritz und Blitz.
Sie schreiben Gottes Namen
in die Krone der Zieraprikose,
und wenn sie schlafen, schläft
der Tag. Sie haben kein Ziel
und erträumen, was sie sind.
Vincent maquillé
Allem, was verschwindet
Die Sommeradresse.
Hier ist ein mit pötterndem Auspuff den Berg (Hügel) hinaufkriechender Wagen schon ein Ereignis.
Der Ophelia-Zoom.
Das Lichtflimmern oben auf den Falschen Akazien, ein leuchtender Deckel, ein Lichtverschluss, an den Straßen über die freien, grünen Grasebenen zwischen den dunklen Waldflächen des Schwarzwalds – nur die annähernde Beschreibung (noch) möglich. (Erzgrube, 3.7.)
Oscar Wildes Leben und Oscar Wildes Sterben stellen nicht die Kapitulation des Einzelnen vor der vermeintlichen Allmacht von Staat, Repression und Politik als solcher dar, sondern den Triumph des Dichterischen über den Stumpfsinn. Wildes allerletzter literarischer Text, seine große Ballade vom Leben und Sterben im Zuchthaus Reading verdeutlicht dies anhand seines abschließendes Wortes: sword – Schwert. (Lies nach!)
Allem, was verschwindet, nehme ich mich an.
Den ganzen Tag lang das Katakombengefühl. (Maulbronn, 21.7.)
Arcade Fire – Neon bible
Arcade Fire – The suburbs
Ein leeres Ruderboot löst sich vom Anleger und treibt auf dem Neckar flussabwärts. Zuerst entdeckt das Malheur der Hund des Bootsverleihers, eine große schlanke Münsterländerhündin, die nervös auf dem Pier hin und her rennt. Und der Bootsverleiher selbst kommt aus seinem Verschlag gestürzt, springt in ein anderes Boot und rudert dem abgetriebenen nach, um es ins Schlepptau zu nehmen. Während sein Hund am Anleger von Boot zu Boot springt, ihm nach über dem grünen Wasser voller Forellen und Enten. (Tübingen, 26.7.)
Unter der nächtlichen Brücke tost der Buëch hindurch, hinweg über die im Mondschein kahlweißen Felsen. Die Brücke ist aus Beton, doch einzelne Überreste der alten, mittelalterlichen Steintraverse stehen noch am schattendunklen Ufer, als hätte der Bergfluss, Strom geworden, die Bögen und Pfeiler abgebrochen und davongetragen, ja so laut braust der Buëch, der talwärts der Durance entgegenströmt, dass dir im Dunkel auf der Brücke selbst das verschwundene Kastell hoch oben über den alten, mitteltalterlichen Häusern von ihm abgebrochen und davongerissen erscheint. In seinem Tosen wird es augenblicklang Bild und wirkt die Unweigerlichkeit des Zeitfortgangs illusorisch. (Serres, 3.8.22)
Während zahlloser Wanderungen, Betrachtungen und Lektüren früher überkam mich immer öfter das ungute Gefühl, sie würden mir dazu dienen, sie beschreiben zu können – der funktionalisierte Blick auf die Dinge –, Dinge, die jedoch, vielleicht gerade dadurch, unwirklich blieben. Mit den Jahren zog ich mich deshalb von „den Dingen“ zurück, scheint mir, verschwand aus der Welt, nahm nicht länger schreibend alles auf und daran teil, sondern ließ die Welt Welt sein, die Dinge die Dinge, um sie für mich zu bewahren und zu schützen vor dem schalen Gefühl, sie benutzt zu haben, begann zu erfinden, baute Erfahrung, Betrachtung, Erlebnis um zu Fiktion – als hätte ich einen auf dem Boden liegenden Spiegel zertreten und würde versuchen, die Scherben neu und anders zusammenzusetzen. Seit einiger Zeit wird mir dieses Schreibspiel auch durch das Übersetzen ersetzt – wobei ich immer dringlicher merke, wie sehr mir darin zwar nicht das Schöpferische, doch die erfinderische Selbstbestimmung fehlt. Es ist dank wichtiger Impulse anders geworden – Dickinson, Wilde, Komunyakaa –, tröstliches Zeichen dafür, dass mein erkranktes Schreiben noch gesunden, sich wiederbeleben und umorientieren kann. Ich gehe hinaus unter die Dinge – the things, das Andere –, nicht, um sie aufzuschreiben, sondern hoffe, dem Blick, der der meine ist, gehen ab und an wieder die wunden Augen auf. (Volx, 4.8.)
Il faut être absolument uncool.
Der lange Abschied

Die Aufnahme zeigt ein Frachtschiff kurz vor dessen Verschrottung 1977 im Hafen der zweitgrößten taiwanesischen Stadt Kaohsiung, seinerzeit eines der weltweit wichtigsten Abwrackungszentren. Die dargestellte betagte Schönheit ist der beladen maximal 8179 Tonnen schwere Stückgutfrachter „Golden Crown“, vom Stapel gelaufen 1948 im schwedischen Göteborg, der fast dreißig Jahre lang unter panamesischer Flagge fuhr und drei Mal einen anderen Namen trug: Die „Golden Crown“ hieß zunächst „M/S Guayana“, dann „Stena“, gefolgt von „M/S Rhodos“, ehe sie ihren letztgültigen Namen erhielt. Sie stellte nichts Besonderes dar – nur ein Frachtschiff, das kreuz und quer über die Weltmeere fuhr, Ladungen nach, notwendigen Reparaturen Rechnung tragend, ein typischer Cargodampfer vor Einführung der Container, die für Frachter, Frachterreedereien und Frachterseeleute alles veränderten.
Und doch gibt es wie bei jedem Ding, jedem Geschöpf eine Besonderheit, die dieses Schiff einmalig macht, mag man es ihm auch nicht ansehen und hätte sich lächelnd oder gar angewidert abgewandt, wäre die „Golden Crown“ Mitte der 70er an einem wie mir auf der Elbe vorbeigefahren – wobei ich nicht weiß, ob sie je auch in Hamburg festgemacht hat und gelöscht wurde.
Als sie noch die junge, schnelle, effektive „M/S Guayana“ war, bestand ihre Besonderheit darin, auf direktem Weg zwischen Los Angeles und London zu verkehren und aufgrund ihrer seinerzeit großzügigen Ausstattung dabei bis zu 46 Passagieren an Bord Platz zu bieten.
Eine solche Frachtschiffatlantiküberquerung auf der „M/S Guayana“ buchte 1952 Raymond Chandler für seine Frau Cissy und sich, eine dreiwöchige Reise, die von Kalifornien durch den Panamakanal, vorbei an Kuba und über die See bis Schottland, bis England führte.
Chandler, der alles und jedem gegenüber kritisch war, fühlte sich wohl an Bord der „Guayana“, auch wenn das Schiff, wie er schrieb, fortwährend neu lackiert wurde. Er arbeitete auf hoher See an der Fertigstellung seines späten Meisterwerks „The Long Good-Bye“, um in London seinem britischen Verleger Hamish Hamilton von seinen Fortschritten berichten zu können.
Doch die Reise auf der „Guayana“ war mehr für ihn. Seit seinem Studium am Dulwich College im Herzen Brite, empfand Chandler sein Leben in La Jolla bei Los Angeles als Zwangsdasein im kalifornischen Exil. Die „Guyana“ entführte ihn für mehrere Monate in die Freiheit der Selbstbestimmung, bevor es zurückzukehren galt. „Auf ganz Kalifornien“, schrieb Raymond Chandler, „trifft zu, was jemand mal von der Schweiz gesagt hat: un beau pays mal habité.“
Aus der Geschichte der Zerrüttung
Das Mädchen ging vorbei und fragte in ihr Handy – oder war da jemand neben ihr? –, ob eine Mücke, von der sie gerade gestochen worden sei, ob die eigentlich sterben müsse jetzt? (Calw, 6.5.22)
Die Blumensträuße, die er nicht hat verkaufen können, bindet der Händler am Abend auf und legt sie in den Brunnen, wo sie daraufhin eine Woche lang schwimmen und blühen.
Mir kommen die Fachwerkfassaden hier wie Sparbücher vor: lauter Ziffern an den Hauswänden.
Mit dem Krankengymnasten unterhältst du dich jede Woche einmal eine Stunde lang über Celan, Bachmann, über Debussys und Ravels Streichquartette und Keith Jarrett. Im Hintergrund laufen Brahms und Bruch, während seine Hände deinen Fuß retten.
Und wenn die junge Frau lacht, schallt es über den Marktplatz – jahrhundertaltes Lachen. Ein Junge im Nachbarlokal ahmt sie nach, auch das erkennen die Fassaden wieder.
Am Boulevard brennt ein Mülleimer, dann das daran angeschlossene Fahrrad und schon auch der dagegengekippte Motorroller. (Paris, Odéon, 18.5.22)
Während er seine Knackwurst verspeist, fragt der Modeverkäufer mit der Tolle nach dem Stoff meines Sommerhemds.
Die Schattenglasur an den Calwer Fassaden und der Lichtschimmer über der Seine.
Henry Purcell und Alfred Deller – Music for a while
Der Panzer zerstört alles. Die Blume lässt sich von allem zerstören.
Das Schwimmbad hat ein neues Gewitterwarnsystem.
Der Turmfalke über Bad Teinach: schwarzweiß, mit roter Musterung. Er ist ein mächtiger Feind, groß wie ein Kind, wenn es Schwingen hätte. (25.5.22)
Die einzige Gestalt, die am Abend noch über den Platz streicht, ist eine schwarzweiße Katze, und vom Glockenläuten lässt sie sich nicht beirren, es ist Teil ihrer Welt, seit sie Katze ist.
Wie immer dieses ungute, von Verblüffung unterlaufene Tarantinogefühl, auch bei „Once upon a time … in Hollywood“. Die Seichtheit und die Blutrünstigkeit. Die Inszenierung der Inszenierung. Und die schöpferisch wehrhafte Abänderung der sogenannten Realität hin zu einer erfüllteren Wirklichkeit – so schroff wie schal, verpufft alles im Qualm einer Zeit ohne Esprit.
„Die einzige Verbindung zwischen Kunst und Natur ist eine tadellose Knopflochblume.“ Oscar Wilde
Pompidou
Michelle
Wenn wir im Souterrainhalblicht des Ladens standen und
die Finger blätterten durch leicht gekippte Klarsichthüllen
alphabetisch einsortierter Platten, blieb für sieben Songs
die Schwerkraft aus. Wir fühlten alles, hörten jede kleine
Atempause, sahen einander auf den Händen balancieren
Alben und in allen Blicken die Musik entstehen zum Bild,
zur Zeile auf dem Cover. Und vorm Fenster war die Pest,
Gertrudenkirchhof, Tote taumelten lebendig auf den Platz,
Staub tanzte in der Luft, die fade, dumpf und unecht roch,
und alles das erwarteten wir und erkannten wir neu jedes
Mal, als hätten wir an Tagen, die wir nicht im Laden waren,
den Geruch an uns gehabt, herumgeschleppt durch träge
Tage, bis die Schwerkraft wieder ausfiel. Kein Gedächtnis
schöpfte unsere Tiefe aus. Und alle Kindheit war verflogen.
Und Alter zählte nicht. Und Seele war uns nahe Gegenwart,
und Welt immer dieselbe und die Einsamkeit neu jedes Mal.
Fortingbras in Saarbrücken
Wegweiser
Die Wörter Freundschaft, Frau und Liebe, die Wörter
Verzeihen und Betrügen, fast hätte ich mich darüber
vergessen. Eine kleine Veränderung reicht aus, und
ich verschwinde in Träume, in Bücher, ja Kochtöpfe.
Meine Zunge wird mich verraten, der eigene Atem
mich umbringen, leider bittere Wahrheit. Ich werde
in Tau verwandelt und Asche, in Qualm, Schatten
an den Wänden, in Zündholzzischen und Flamme,
in die zerknüllte Stelle im Laken, in das Getropfe
des Wassers im Bad. Eine Epoche hinter mir und
kein Funkeln mehr im Blick, ist die Zeit ja wohl reif,
um alles hinzuwerfen. Ich zerfalle wie ein Konzern.
Ich breche zusammen ähnlich einem Imperium und
werde verhaftet wie ein Fußballgott. Zum Teufel mit
allem Gras. Ich werde jeden Anschluss verpassen,
ihr werdet’s erleben, meine Welt endet, das war’s.
Keine peinliche Begegnung mehr im Treppenhaus,
endgültig Vergangenheit die ganzen Zufallstreffen
am Brotstand im Supermarkt. Bleibt nur, ich gehe.
Schluss mit Verabredungen unter der großen Uhr,
die steht, oder stehen geblieben sein muss, egal,
so elendig langsam vergehen darauf die Minuten.
Nach Tomasz Różycki
Clapham Junction
Bewaffnet sind die Toten aus dem Grab gestiegen
Und flattern da in Wahrheit auch bloß Londoner Tauben
Die Zunge erkundet die Mundhöhle und weiß auf einmal
Die Jahreszeit des Kummers ist ein Vorstadtbahnhof
Und flattern da in Wahrheit auch bloß Londoner Tauben
Über Waggons voller Stahlschrott, Spänen und Schotter
Die Jahreszeit des Kummers ist ein Vorstadtbahnhof
In der so seltsam simplen Ökonomie der Welt
Über Waggons voller Stahlschrott, Spänen und Schotter
Die Lavendelhügel, die Lavendelfelder
In der so seltsam simplen Ökonomie der Welt
Spucken sie auf dich, Oscar, Ausgeburt allen Übels du
Die Lavendelhügel, die Lavendelfelder
Es war das reinste Gelage mit Panthern
Spucken sie auf dich, Oscar, Ausgeburt allen Übels du
Nimm es hin wie den ewigen Nebel und den Nieselregen
Es war das reinste Gelage mit Panthern
Die Zunge erkundet die Mundhöhle und weiß auf einmal
Nimm es hin wie den ewigen Nebel und den Nieselregen
Bewaffnet sind die Toten aus dem Grab gestiegen
Die Kaue
Eisenbach
Wach auf, mein Herz, und weise wisse
Wir haben bei Weitem noch nicht alles geliebt
Denk nur an den Baum, der neben uns stand wie ein Lauschender
Der Sommer ein Jahr und die Glaswand nicht Glas
Wir haben bei Weitem noch nicht alles geliebt
Vergiss nicht, jede Uhr ist erfunden
Der Sommer ein Jahr und die Glaswand nicht Glas
1975 entdeckt man in China die Zärtlichkeit
Vergiss nicht, jede Uhr ist erfunden
Wie eine böse Knospe, in der eine furchtbare Blüte wartet
1975 entdeckt man in China die Zärtlichkeit
Als wäre es gestern gewesen, heute, jetzt
Wie eine böse Knospe, in der eine furchtbare Blüte wartet
Der Wind von den Sternen, die alle Sonnen sind
Als wäre es gestern gewesen, heute, jetzt
Scheuchen nachts Böen das Laternengelichter aus dem Kanal
Der Wind von den Sternen, die alle Sonnen sind
Denk nur an den Baum, der neben uns stand wie ein Lauschender
Scheuchen nachts Böen das Laternengelichter aus dem Kanal
Wach auf, mein Herz, und weise wisse
Fleur en glace
Calw
Da legt eine Prau an, im scheinbaren Wind aus nichts Segel
So klingt der süße Singsang von den allerschwersten Dingen
Piet gießt vor dem Laden um Mitternacht noch die Narzissen
Unverkäufliche Blumen schwimmen eine Woche im Brunnen
So klingt der süße Singsang von den allerschwersten Dingen
Fast schmeckt der Regen nach dem Wein in meinen Händen
Unverkäufliche Blumen schwimmen eine Woche im Brunnen
Zwei Absätze weiter unten in der Geschichte der Zerrüttung
Fast schmeckt der Regen nach dem Wein in meinen Händen
Wie Sparbücher voll Ziffern morgens die Fachwerkfassaden
Zwei Absätze weiter unten in der Geschichte der Zerrüttung
Ich wusste überhaupt nicht, dass ich vollkommen nackt bin
Wie Sparbücher voll Ziffern morgens die Fachwerkfassaden
Und der Marder im Dachstuhl entkommt durch die Träume
Ich wusste überhaupt nicht, dass ich vollkommen nackt bin
Während David Crosby auf dem Markt Wooden Ships singt
Und der Marder im Dachstuhl entkommt durch die Träume
Piet gießt vor dem Laden um Mitternacht noch die Narzissen
Während David Crosby auf dem Markt Wooden Ships singt
Da legt eine Prau an, im scheinbaren Wind aus nichts Segel
Bleu de Nice
Nizza
Schon verlässt das Gedicht das Bleistiftstadium
Kaum dass ein Baum dort in der blauen Dünung treibt
Kein Kletterer im Berg kennt den Berg, aber du
Wie eine alte Seemöwe nachts bei Mistral
Kaum dass ein Baum dort in der blauen Dünung treibt
Klirren die Sternbilder, bis du dich in Bewegung setzt
Wie eine alte Seemöwe nachts bei Mistral
Nur ein Häufchen Kiesel und Zigarettenkippen
Klirren die Sternbilder, bis du dich in Bewegung setzt
Dann schreckt manchmal sogar ein Schatten zurück
Nur ein Häufchen Kiesel und Zigarettenkippen
Freude zu finden bleibt trotzdem der Sinn einer Passeggiata
Dann schreckt manchmal sogar ein Schatten zurück
Und sei er aus den verschwundenen Wäldern des Libanon
Freude zu finden bleibt trotzdem der Sinn einer Passeggiata
Bis die Wellenbrecher alles achtlos zertrümmern
Und sei er aus den verschwundenen Wäldern des Libanon
Kein Kletterer im Berg kennt den Berg, aber du
Bis die Wellenbrecher alles achtlos zertrümmern
Schon verlässt das Gedicht das Bleistiftstadium
Ein Glas Tränen
Trink das Glas, trink es und
Sommerwolken spiegeln sich.
Das Wasser fließt, ein Fließen
geht durch alle deine Jahre.
Grün der See, grün Seele.
Also fürchte dich nicht mehr,
die Sommerwolken spiegeln sich
auf Fluss und See. Im grünen Licht
trink aus dein Glas, trink es ganz leer.
2. Fassung