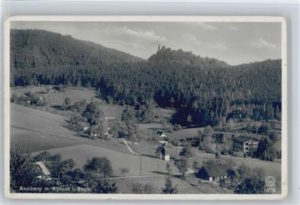Lauter als der lauteste Punk, der lärmigste Death Metal, der sich aus der Nachbarwohnung durch die Wände drillt: das Singen der Vögel im Innenhof.
Bau ein Haus, aber lass die Haustür offen.
Das Kind hat einen Ast im Park gefunden und mitgenommen nach Haus, in sein Zimmer, wo es den Ast, an dem ein paar letzte Zweige sind und sogar halb vertrocknete Blätter, neben das Bett legt. Dort liegt der Ast in der Nacht. Fragt man das Kind, was der Ast soll, bekommt man zur Antwort: „Nichts, der Ast soll nichts. Außerdem ist er kein Ast.“
OMD – Dazzle Ships
Vor dem Haus wird eine grün bemooste, fast braune Straßenlaterne ausgetauscht gegen eine neue, noch ganz blanke, beinahe wie verchromte. Frag den Baustellenleiter, ob er weiß, wie lange die Laterne hier gestanden hat, an ihrem Laternenlichtort, und er, der dickbäuchige Mensch in dem Unterhemd und der Latzhose, antwortet ohne zu zögern – doch, er zögert, aber unmerklich oder kaum merklich, denn er ist auch bloß ein Mensch – bloß? –: „49 Jahre, seit 1969, deshalb wechseln wir sie, Laternenvorschrift. Laternen 49, Ampeln 29 Jahre, die sind schwerer.“ Frag ihn, ob er weiß, wieviele Ausfälle diese eine, diese besondere, weil deine, vor deinem Fenster stehende, nein nicht mehr stehende Laterne gehabt hat in 49 Jahren, und er antwortet nach einem Blick in seine Laternenliste: „Keine. Hat anscheinend immer gebrannt. Geschienen. Zuverlässig, die alte Herzogin.“ 9,50 m sei sie hoch, sagt der Baustellenleiter, desgleichen die baugleiche neue. Der Austausch ist nach anderthalb Stunden erledigt und vollendet. Die Laterne, die keine mehr ist, wird auf der kurzfristig abgesperrten Wohnstraße zersägt und verladen. Licht aus, Frau Herzogin. (Barmbek, 19. April)
Umspannwerk im grünen Gras voller Butterblumen. (Ulm, 20.4.)
Erinnere dich an Wittfeitzen, Wendland 1979, das kirchliche Feriencamp, die stillen, sonnendurchpulsten Wälder rings um den weitläufigen Zeltplatz. Es war kein Idyll, mit Romantik – Nullbegriff – hatten die Wochen nichts zu tun. Alles brach auf und wurde Neues, Ungeahntes. Abscheu und Abenteuer waren beinahe eins. Auf einmal liefst du allein durch die Welt, ungesehen, unbeobachtet, bereit, verloren zu gehen und wurdest ich. Hinzu kam das Erzählen, das Phantastische der Phantasie – denn da erzählte jeden Abend der Küster seine Geschichten, seine aus dem Stegreif erfundene, weitergesponnene Erzählung, und wir lauschten und blickten einander in die Gesichter, du und ich.