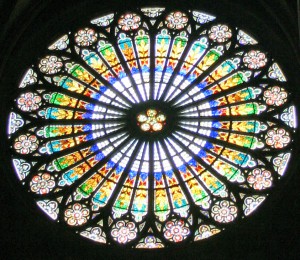Giftige Wegelagerer – eine Bande aus Fingerhut. Wo über Natzwiller der Wald ansteigt und die Vogesen zum Hochwald werden, warten zu beiden Seiten des Gebirgsbachs die getüpfelt rosa maskierten Banditen. Alle Blütenkelche haben sie zur von den Wasserfällen herabrauschenden Serva hin weit geöffnet. So wie ich scheinen sie zu lauschen auf das Prasseln des klaren, immer klareren Wassers. Doch sie, die Fingerhütlinge, schwanken nur leicht, während ich hinunter zum Bach gehen und von dem Wasser kosten kann: Es schmeckt nach Rost, der roten Erde, dem dunklen Wald, nach Gras.
In einem Garten neben einem Traktorenschuppen stand dunkelgrün im plötzlich sommerschönen Tag eine Staude voller schwarzer Johannisbeeren, und unweit von ihr, in einem kaum mannshohen und kahlgefressenen Birnbaum, das genaue (nicht aber exakte) Abbild der Beerenpracht: ein Schwarm Spatzen schwirrte da auf, nur nicht wind-, sondern flügelbewegt, beschwingt (Natzwiller, Vallée de la Rothaine, 16. Juli).
Die Dummheit, die Gedanken- und Fühllosigkeit, sie ist immer da, tu doch nicht so! Sie ist so nah – immer Teil von dir. „Haslach“, dachte ich, wie seltsam, aus Hausach bei Haslach im Kinzigtal zu kommen, hierher-hinüber in die Vogesen zu fahren und auch an der durch die Berge rauschenden Hasel ein Ober- und Nieder-, schließlich ein Haslach zu finden.
In Haslach an der Kinzig, lese ich, stand eines der berüchtigsten Außenlager des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof. Tausende Häftlinge wurden im Winter 1944/45 von Natzwiller an der Serva nach Haslach an der Kinzig getrieben, um sich dort zu Tode zu schuften. In Natzwiller hatten sie für Speers geplante Monumentalbauten roten Granit abzubauen, der rötliche Stein, die rotbraune Erde, überall in den Wäldern, 600, 800 m über dem Meer, fielen sie mir ins Auge. Und das leuchtend grüne Gras. An „Le Struthof“ fuhr ich ein dutzend Mal vorbei, fast in Rufweite liegt es von Natzwiller – und hatte keinmal den Impuls, herauszufinden, warum alle die Schilder in den höher gelegenen Nachbarort weisen.
Wäre ich denn, entscheidende Frage, hingefahren, wenn ich von der Gedenkstätte gewusst hätte? Ich hätte geschwankt – und es dabei wohl bewenden lassen. Dabei hätte ich mir doch auch dort das Gras ansehen können, das leuchtend grüne Gras von Natzweiler-Struthof, von dem ich lese: „Ein Häftling grub während der Arbeit im Steinbruch unbemerkt ein Loch in die Erde und bedeckte sich mit Gras, um nicht gesehen zu werden. Nachdem die anderen Häftlinge am Abend ins Lager zurück mussten, blieb er die ganze Nacht über in seinem Versteck. Tatsächlich war er der Flucht sehr nahe, denn am nächsten Morgen war noch nichts aufgefallen. Beim Morgenappell aber fehlte der Mann und wurden Suchhunde eingesetzt“ …
Es handele sich, sagt W.G. Sebald in einem seiner letzten Gespräche, „um eine dieser Koinzidenzen, an denen einem schlagartig aufgeht, daß alles mit allem zusammenhängt und daß man sich deshalb um die Dinge kümmern muß.“ Es sei, so Sebald, „ein riesiges Netzwerk des Schmerzes, das nach wie vor seine Auswirkungen hat.“