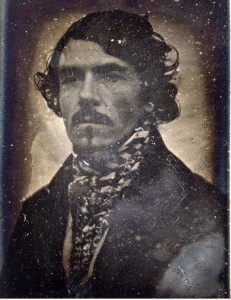Da ist er wieder: der auf Zehenspitzen, mit durchgestrecktem Rücken, erhobenem Kopf und oft ausgebreiteten Armen und sehr geradeaus blickendem Gesicht vor dem Haus vorübergehende Mann – der so erstaunlich unwirsch ist, wenn du ihm zu nahe kommst. Der unfreundliche Engel. (18.8.)
„Sie sind ein KA28B-Fall, ich verstehe“, sagt die Dame vom Telekom-Störungsdienst am Telefon.
„Alle tot“, sagt der alte Dichter, während er in seinem Telefonverzeichnis blättert. „Tot. Tot. Tot. Tot. Tot. Aber der S., wo ist der? Der ist doch noch nicht tot … Aber die hier: tot. Tot. Tot. Tot …“
„Ach, Elend. Nicht mein Tag …“ – was soll das bedeuten? Gerade die elenden Tage sind und waren ja schon immer deine. Und haben dich zwar nicht weitergebracht, nein, wohin auch, aber doch spüren lassen, was du bist: am Leben. (21.8.)
Keinen Trinker darfst du verdammen. Die Trinker ertrinken – und sie zeigen dir den Weg, der ins Ertrunkensein führt.
Trakl hatte recht, nicht absolut, sondern wirklich: Alle Menschen sind der Liebe wert. Jeden könntest du lieben. Die Frage ist nur: Warum tust du’s nicht?
Die Frau mit den schönen Wimpern: In der S-Bahn steht einer auf und sagt zu ihr: „Entschuldigen Sie, Ihre Wimpern … sind wunderschön“ – und geht und steigt aus. Erst da fällt dir auf, wie recht er hat.
Eine Zeitlang war ich in einem Baumklub. Aber irgendwann wurde ich hinuntergeworfen.